
Für eine differenzierte Therapie stehen immer mehr Optionen zur Verfügung
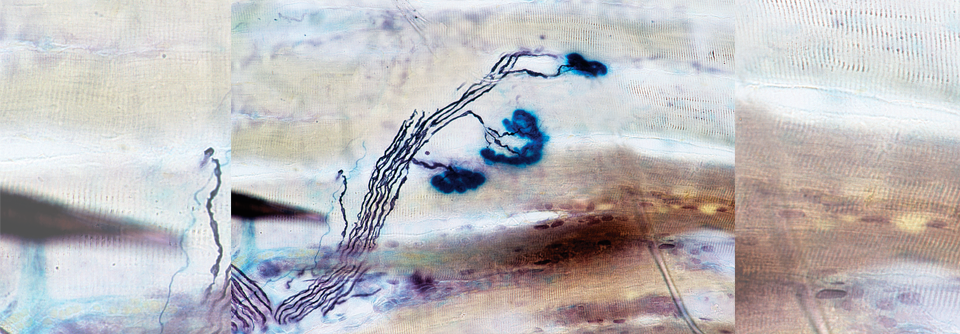 In epidemiologischen Studien wurde gezeigt, dass die Inzidenz der MG vor allem bei über 65-Jährigen ansteigt.
© Science Photo Library - Microscape
In epidemiologischen Studien wurde gezeigt, dass die Inzidenz der MG vor allem bei über 65-Jährigen ansteigt.
© Science Photo Library - Microscape
Das pathophysiologische Verständnis für die generalisierte Myasthenia gravis (gMG) wird immer besser. Dies habe seit etwa zehn Jahren zu zahlreichen neuen Therapieansätzen und zur Erforschung neuer Biomarker geführt, schreiben Forschende um Dr. Sophie Binks, University of Oxford. Das sind die fünf wichtigsten Neuerungen der letzten Jahre:
1.Thymektomie als Meilenstein
Ein wichtiger Meilenstein war der 2016 erfolgte Nachweis, dass die Thymektomie auch bei der thymomfreien MG wirksam ist. Dahinter steht die Erkenntnis, dass der Thymus die Hauptquelle für die Autoimmunisierung und die Bildung Autoantikörper sekretierender Zellen darstellt. Inzwischen kann der Eingriff in vielen Fällen minimalinvasiv durchgeführt werden.
Die aktuelle Forschung fokussiert auf die histologische Differenzierung des Thymusgewebes, mit der sich der Verlauf möglicherweise besser vorhersagen lässt. Bei etwa 15 % der Erkrankten sind keine AChR-Antikörper nachweisbar, sondern Antikörper gegen muskelspezifische Kinase (MuSK) oder LDL-Rezeptor-assoziiertes Protein 4 (LRP4). Noch ist unklar, ob auch diese Betroffenen von einer Thymektomie profitieren.
2.Neue Immuntherapien
Nach dem heutigen pathophysiologischen Verständnis hat die Therapie der MG drei wichtige Ziele: Das Entfernen der Effektorzellen, die pathogene Autoantikörper produzieren (oder der Autoantikörper selbst), den Schutz der neuromuskulären Endplatte sowie die Reduktion oder sogar den Stopp der Autoimmunisierung. Die früher eingesetzten Immunsuppressiva wie Kortikosteroide und Azathioprin weisen zahlreiche Nebenwirkungen auf und können die Erkrankung nicht immer ausreichend kontrollieren. Zahlreiche neue Medikamente wurden und werden aber zurzeit in klinischen Studien geprüft.
Zum Schutz der motorischen Endplatte vor den AChR-Antikörpern wird der gegen C5-Komponenten der Komplementkaskade gerichtete monoklonale Antikörper Eculizumab eingesetzt, der 2017 zur Therapie der AChR-positiven MG zugelassen wurde. Weitere C5-Antikörper in klinischer Prüfung sind Ravulizumab und Zilucoplan.
Ein anderer Ansatz ist die Hemmung des neonatalen FcRN-Rezeptors, der wichtig für das Recycling zirkulierender IgG-Antikörper ist. Durch die Blockade werden die Antikörper um bis zu 70 % reduziert. Diese Therapie könnte ersten Daten zufolge auch für Erkrankte mit MuSK-MG eine Option sein.
Substanzen wie der monoklonale CD20-Antikörper Rituximab ziehen ebenfalls zirkulierende IgG-Antikörper aus dem Verkehr. Rituximab wird bereits bei vielen anderen Autoimmunerkrankungen eingesetzt. In ersten, kleineren Studien hat es bei MG einen positiven Effekt gezeigt. Wahrscheinlich ist es am wirksamsten, wenn es in einem sehr frühen Krankheitsstadium eingesetzt wird.
Zahlreiche weitere Therapieprinzipien werden aktuell noch geprüft, etwa die IL-6-Rezeptor-Blockade und die B-Zell-Depletion. Besondere Hoffnungen liegen auf der CAR-T-Zell-Therapie. Sie gilt als potenziell krankheitsmodifizierend, die hohen Kosten und mögliche Nebenwirkungen werfen jedoch noch Fragen auf.
3.Evidenzbasierte Leitlinien
Nachdem die Therapie lange Zeit nur auf Expertenmeinungen basierte, gibt es zumindest für die AChR-AK-positive gMG inzwischen evidenzbasierte Leitlinien. In den aktuellen Updates haben auch neuere Therapien wie die Thymektomie und einige der genannten Immuntherapeutika Eingang gefunden.
4.Biomarker für die Präzisionstherapie
Auch wenn sie es noch nicht in die klinische Praxis geschafft haben, werden bereits zahlreiche Biomarker untersucht, die zur besseren Einschätzung der Prognose oder zur Differenzierung von MG-Subtypen genutzt werden könnten. Dazu gehören neben den IgG-Subklassen die miRNAs, Hitzeschockproteine, Neurofilament-Leichtketten und das Darmmikrobiom.
5.Erkenntnisse über den optimalen Therapiezeitpunkt
In epidemiologischen Studien wurde gezeigt, dass die Inzidenz der MG vor allem bei über 65-Jährigen ansteigt. Diese Late-Onset-Fälle sind deutlich häufiger geworden, während die Zahl der früh auftretenden Fälle relativ konstant geblieben ist. Von der Late-Onset-MG abzugrenzen sind die zunehmenden Fälle älterer Menschen, die schon sehr lange mit ihrer Erkrankung leben. Am effektivsten scheint die Therapie in den ersten zwei Jahren nach Krankheitsbeginn zu sein – unabhängig vom Alter. Bei älteren Betroffenen müssen zahlreiche Komorbiditäten mit berücksichtigt werden, die zum Teil auch durch Medikamente bedingt sind.
Quelle: Binks SNM et al. J Neurol 2025; 272: 226; DOI: 10.1007/s00415-025-12922-7
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).

