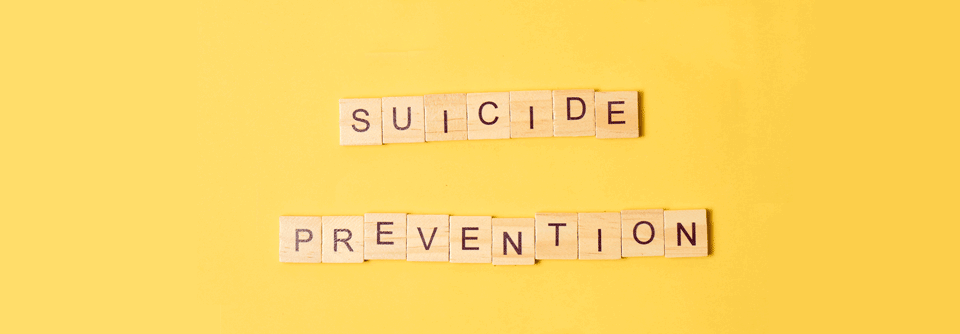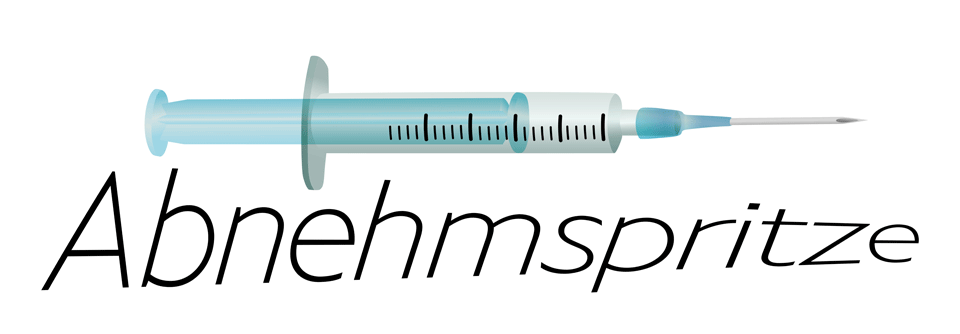
GLP1-Rezeptoragonisten verdoppeln Risiko für Makulaschäden
 Immer mehr Studiendaten bringen GLP1-Rezeptoragonisten mit Augenerkrankungen in Verbindung.
© Orawan - stock.adobe.com
Immer mehr Studiendaten bringen GLP1-Rezeptoragonisten mit Augenerkrankungen in Verbindung.
© Orawan - stock.adobe.com
Immer mehr Studiendaten bringen GLP1-Rezeptoragonisten mit Augenerkrankungen in Verbindung, etwa mit diabetischer Retinopathie oder nichtarteriitischer anteriorer ischämischer Optikusneuropathie (NAION). Eine aktuelle Studie aus Kanada hat nun eine Assoziation zur neovaskulären altersbedingten Makuladegeneration (nAMD) festgestellt.
Die Studienbasis der kanadischen Wissenschaftlergruppe bildete eine Kohorte von Menschen mit Typ-2-Diabetes. Voraussetzung für den Einschluss in die Untersuchung war ein Mindestalter von 66 Jahren. Das Team um Dr. Reut Shor von der Universität Toronto matchte 46.334 Frauen und Männer mit der Stoffwechselstörung und mindestens sechsmonatiger GLP1-RA-Medikation im Verhältnis 1:2 gegen 92.668 Kontrollpersonen mit Typ-2-Diabetes, aber ohne die Medikation. In 97,5 % der Fälle kam Semaglutid zum Einsatz. Während eines Follow-ups von durchschnittlich knapp zweieinhalb Jahren wurde das Auftreten einer nAMD erfasst.
Risiko für Makulaschäden war mehr als verdoppelt
Unter GLP1-RA war das Risiko, in den Folgejahren an nAMD zu erkranken, mehr als doppelt so hoch (Hazard Ratio 2,21). Je länger das Inkretinmimetikum eingenommen wurde, desto höher lag auch die Wahrscheinlichkeit für die Augenkrankheit.
Womöglich führt das Medikament durch die schnell herbeigeführte glykämische Kontrolle zu einer temporären retinalen Hypoxie, was die choroidale Neovaskularisation antreiben könnte, mutmaßen Dr. Shor et al. Ein derartiger Mechanismus werde auch für die Entstehung der NAION unter GLP1-RA-Therapie diskutiert. Bei längerer Anwendung vermuten sie einen GLP1-RA-initiierten Anstieg des Cytokins CXCL12 als Risikotreiber.
Auch wenn das absolute Risiko mit einer Inzidenz von 0,2 % gegenüber 0,1 % bei den Kontrollpersonen niedrig ist, könnte dies – auf Millionen Anwenderinnen und Anwender übertragen – in einer beachtlichen Zahl Betroffener resultieren, betont Prof. Dr. Brian VanderBeek, University of Pennsylvania in Philadelphia. Entscheidend sei, ob sich die Assoziation in künftigen Arbeiten auch für andere GLP1-RA-Indikationen und weitere Wirkstoffe bestätigt. Den hohen Stellenwert der Inkretinmimetika im Diabetes- und Gewichtsmanagement sieht Prof. VanderBeek durch die Ergebnisse aber nicht geschmälert. Man müsse sich jedoch vor jeder GLP1-RA-Therapie bewusst sein, das ernsthafte ophthalmologische Komplikationen auftreten können.
Quelle:
1. Shor R et al. JAMA Ophthalmol 2025; 143: 587-594; doi: 10.1001/jamaophthalmol.2025.1455
2. VanderBeek BL. JAMA Ophthalmol 2025; 143: 594-596; doi: 10.1001/jamaophthalmol.2025.1599
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).