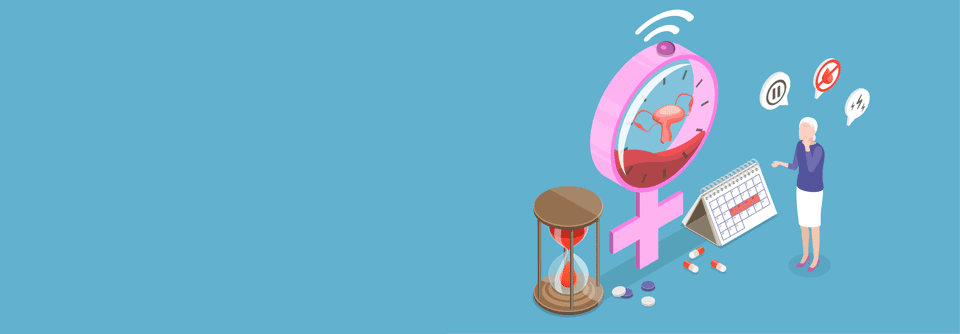Hyperhidrose ist mehr als ein Ärgernis
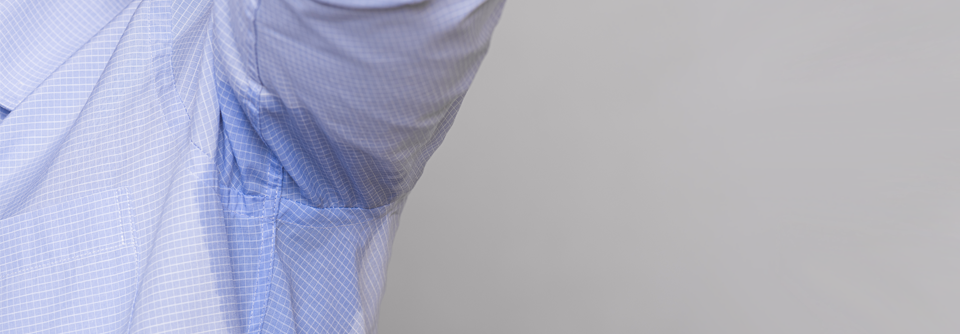 Die idiopathische Hyperhidrose beginnt meist im jungen Erwachsenenalter.
© Siam - stock.adobe.com
Die idiopathische Hyperhidrose beginnt meist im jungen Erwachsenenalter.
© Siam - stock.adobe.com
Hyperhidrose ist recht weit verbreitet. Für die USA schätzt man, dass etwa 5 % der Bevölkerung daran leiden. Zugleich wird die Erkrankung aber viel zu selten diagnostiziert, schreiben Dr. Mitchell Lysett vom Royal North Shore Hospital in Sydney und Prof. Dr. Karl Ng von der dortigen Universität. Das liege auch an den Betroffenen selbst: Weniger als die Hälfte von ihnen sucht ärztliche Hilfe. Tatsächlich fühlt sich aber jeder zweite Mensch mit Hyperhidrose durch die Erkrankung in seiner Lebensqualität beeinträchtigt.
Die für andere wahrnehmbaren Folgen wie Schweißflecken an der Kleidung oder ein unangenehmer Körpergeruch sind den Betroffenen peinlich. Im Job verstärken sich die Probleme durch angstauslösende Situationen oft noch, etwa beim Halten eines Vortrags. Bei fokaler palmarer Hyperhidrose erschweren die schweißnassen Handflächen das Halten von Gegenständen oder die Fähigkeit zu schreiben. Viele Erkrankte scheuen sich vor sozialen und intimen Kontakten. Auch für die Haut wird das übermäßige Schwitzen zur Herausforderung. Irritationen und Infektionen können die Folge sein.
Die idiopathische Hyperhidrose beginnt meist im jungen Erwachsenenalter. Sie tritt überwiegend in der fokalen Form auf, am häufigsten in der Axilla, gefolgt von den Handflächen. Es gibt eine familiäre Häufung, aber keine monogenetische Ursache. Sehr viel seltener ist eine sekundäre Hyperhidrose (siehe Kasten). Die sekundären Formen treten meist generalisiert und nicht vor dem 25. Lebensjahr auf. Typisch ist nächtliches Schwitzen. Bei einer Hyperhidrose sieht man die ekkrinen Schweißdrüsen vergrößert, aber ansonsten ultrastrukturell normal. Zum klinischen Assessment ist die Hyperhidrosis Disease Severity Scale (HDSS) mit ihren vier Punkten am besten geeignet.
Topische Therapien stehen im Management der Erkrankung an erster Stelle, insbesondere bei fokalen Manifestationen. Mit Responseraten von bis zu 98 % haben sich Antitranspirante mit einem Aluminiumchloridgehalt von 15–25 % als hochwirksam erwiesen. Im normalen Handel erhältliche Produkte enthalten lediglich 1–2 %. Aluminiumsalze reagieren mit Mukopolysacchariden in den Ausführungsgängen der ekkrinen Schweißdrüsen. Dabei bilden sich Pfropfen, die die Ausführungsgänge verschließen.
Mögliche Ursachen einer sekundären Hyperhidrose
- Medikamente, u. a. Antidepressiva (v. a. SSRI und Trizyklika), Neuroleptika, Acetylcholinesterasehemmer, Opioide, Immunsuppressiva
- Endokrinopathien wie Diabetes, Hyperthyreoidismus, Akromegalie
- neurologische Erkrankungen, z. B. M. Parkinson, Z. n. Schlaganfall oder Rückenmarkverletzung
- andere systemische Leiden wie Malignome (v. a. Lymphome), chronische Infektionen oder inflammatorische Arthritiden
Wirkung der Deodorante tritt etwas verzögert ein
Die Deodorante trägt man regelmäßig im Abstand von ein bis zwei Tagen auf, am besten nachts, wenn wenig Schweiß produziert wird. Viele Patientinnen und Patienten berichten über Hautirritationen, zumindest leichten Pruritus am Ort der Anwendung. Dieser Nebeneffekt lässt aber mit der Zeit etwas nach. Ein Behandlungserfolg ist nach etwa ein bis zwei Wochen Anwendungsdauer zu erwarten.
Alternativ kann der anticholinerge Muskarinantagonist Glykopyrrolat eingesetzt werden. Zur Verfügung stehen imprägnierte Tücher oder topische Cremes. Responseraten von über 60 % werden berichtet. Anticholinerge Nebenwirkungen sind allerdings keine Seltenheit.
Bei generalisierter und kraniofazialer Hyperhidrose gelten orale Medikamente als erste Wahl. In erster Linie kommen Muskarinantagonisten wie Glycopyrrolat und Oxybutynin zum Einsatz, die Ansprechraten liegen über 70 %. Anticholinerge Nebeneffekte treten noch etwas häufiger auf als bei topischer Anwendung. Für Menschen, die nur in Stresssituationen vermehrt schwitzen, bietet sich Propranolol – regelmäßig oder im Bedarfsfall – an. Auch bei kraniofazialer Hyperhidrose kommt der Betablocker in Betracht, ebenso wie Clonidin.
Bis zu 90 % der Menschen mit palmarer oder plantarer Hyperhidrose profitieren von einer niederfrequenten Elektrotherapie in Form der Iontophorese. Anfangs wendet man sie jeden zweiten Tag für 20–30 Minuten im Wasserbad an, später seltener. Der Wirkmechanismus des Verfahrens ist unklar.
Wenn sonst nichts hilft, kann eine fokale Hyperhidrose auch mit Injektionen von Botulinumtoxin, am besten in die dermoepidermale Junktionszone, behandelt werden. Da die Prozedur an den Handflächen unangenehm ist, empfehlen die Autoren, sie unter Sedierung vorzunehmen. Der Effekt hält zwischen sechs und neun Monaten an. Eine Diffusion des Botulinumtoxins in die nahegelegene Muskulatur kann eine vorübergehende Muskelschwäche hervorrufen.
Ganz am Ende der therapeutischen Optionen steht zum einen die Mikrowellen- oder Laserablation, die ekkrine Schweißdrüsen durch Hitze irreversibel zerstört. Am weitesten verbreitet ist ein Mikrowellensystem, mit dem sich Erfolgsraten von bis zu 90 % erzielen lassen. Es lässt sich aber nur in der Axilla anwenden, nicht bei palmoplantarer Hyperhidrose.
Für die refraktäre palmare Hyperhidrose besteht noch die Möglichkeit der endoskopischen thorakalen Sympathektomie, mit der der sympathische Input zum Zielbereich unterbrochen wird. Oft entwickelt sich danach jedoch eine kompensatorische Hyperhidrose in anderen Regionen, die Betroffene manchmal mehr stört als das ursprüngliche Problem.
Quelle: Lycett M, Ng K. Internal Medicine Journal 2025; DOI: 10.1111/imj.70019
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).