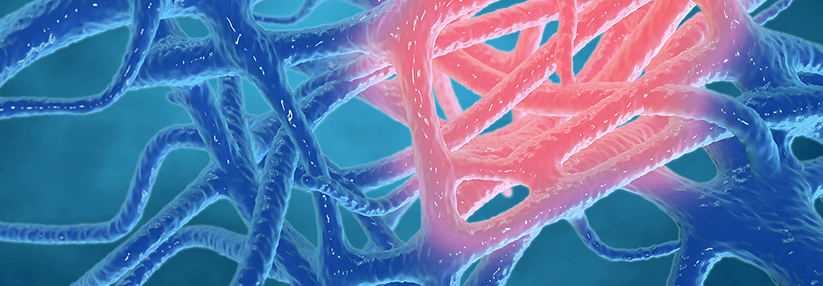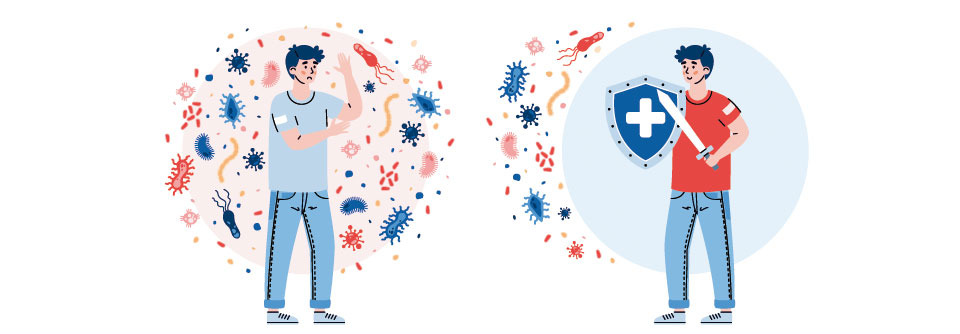Immundefekt: Allgemeinmaßnahmen bilden die Basis jeder Therapie
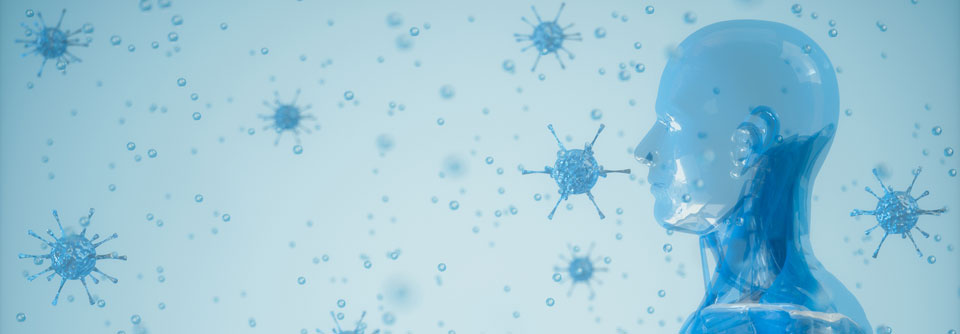 Nicht immer ist das eigene Immunsystem stark genug, um gegen Infektionen anzukommen. Dahinter kann auch ein Immundefekt stecken.
© iStock/onurdongel
Nicht immer ist das eigene Immunsystem stark genug, um gegen Infektionen anzukommen. Dahinter kann auch ein Immundefekt stecken.
© iStock/onurdongel
Abwehrschwächen von Erwachsenen beruhen meistens auf erworbenen Immundefekten, erklären Dr. Dietrich August und Professor Dr. Bodo Grimbacher vom Centrum für Chronische Immundefizienz des Universitätsklinikums Freiburg. Zu den Ursachen gehören die Behandlung mit Immunsuppressiva (z.B. Kortison), eine HIV-Infektion und Grunderkrankungen wie Diabetes oder hämatologische Störungen. Auch anatomische Veränderungen wie etwa Fisteln, Bronchiektasien oder der vesikourethrale Reflux begünstigen eine erhöhte (lokale) Infektanfälligkeit.
Mit einer Prävalenz von etwa 1 auf 37 000 Einwohner sind primäre, also angeborene Immundefekte (s. Tabelle) eher selten. Allerdings gehen die Autoren von einer erheblichen Dunkelziffer aus. Die durchschnittliche Zeit vom Auftreten der ersten Beschwerden bis zur Diagnose dauert mit 5,5 Jahren noch immer viel zu lange, betonen die Experten. Ein Drittel der primären Defekte wird sogar erst im Erwachsenenalter erkannt.
| Primäre Immundefekte (Auswahl) | |||
|---|---|---|---|
| Immundefekt | Ursache | Klinik | Besonderheit |
| Bruton-Agammaglobulinämie | genetisch bedingter Reifungsstopp der B-Zell-Entwicklung | Lymphopenie, Antikörpermangelsyndrom, fehlende Lymphknoten und Rachenmandeln; nach Beendigung des mütterlichen Nestschutzes vermehrt bakterielle Infekte (Otitis, Hautinfektionen, Diarrhö) | abgeschwächte Varianten möglich, die erst im Erwachsenenalter entdeckt werden |
| Variables Immundefektsyndrom (CVID) | heterogene Gruppe von Erkrankungen; Ausschlussdiagnose | Antikörpermangel (IgG und IgA); wiederkehrende Infekte, Granulome, chronisch-entzündliche Darmerkrankungen und Lymphome; bei einer Subgruppe (NfkappaB1-Defizienz) häufig zusätzlich rheumatische Beschwerden und Rosacea | häufigster klinisch manifester primärer Immundefekt; bei zwei Dritteln der Patienten erst im Erwachsenenalter diagnostiziert |
| CTLA4-Defizienz | genetisch bedingte Beeinträchtigung der Funktion der T-Zellen | Immundysregulationssyndrom mit Antikörpermangel, Lymphoproliferation, Autoimmunzytopenien | neu entwickelte CTLA4-Fc-Fusionsproteine Abatacept und Belatacept aktuell als zielgerichtete Therapien geprüft |
| Chronische Granulomatose | genetisch bedingte Fehlfunktion der NADPH-Oxidase; Phagozyten können kaum reaktive Sauerstoffspezies bilden und Pilze und Bakterien nicht abtöten | Bakterielle und Pilzinfektionen von Lunge, Haut, Leber, Lymphknoten und Knochen, Bildung von Granulomen | gastrointestinale Beschwerden häufig, oft als chronisch-entzündliche Darmerkrankung fehldiagnostiziert |
| Wiskott-Aldrich-Syndrom | Mutationen, die zum Fehlen des zytoplasmatischen WAS-Proteins führen; Signalübertragung in Immunzellen ist gestört | Mikrothrombozytopenie, Ekzem und Abwehrschwäche mit vermehrt bakteriellen und viralen Infektionen; häufig Malignome, Autoimmunität und Blutungskomplikationen | abgeschwächte Formen kommen vor, Vollbild muss möglichst früh erkannt werden, therapiert wird mit Stammzelltransplantation |
| Hyper-IgE-Syndrom | Mutationen in unterschiedlichen Genen, die zu außergewöhnlich hohen IgE-Spiegeln führen | IgE oft > 5000 U/ml; Hauterkrankungen mit bakteriellen Abszessen (oft ohne Rötung und Erwärmung), Neugeborenenekzem, Pneumonien, mukokutane Candidainfektionen | tritt sehr selten auf |
Mehr als drei antibiotikapflichtige Infektionen im Jahr?
Die verzögerte Diagnose erhöht Morbidität und Mortalität der Betroffenen. Deshalb gilt es, Hinweise frühzeitig zu erkennen. Wichtiges Merkmal für alle Immundefekte ist die erhöhte Infektanfälligkeit. Besonders oft beobachtet man Entzündungen im Respirationstrakt oder eine Otitis media. Hellhörig werden sollten Hausärzte, wenn ein Patient mehr als dreimal im Jahr unter einer antibiotikapflichtigen Infektion leidet, die länger als drei Wochen dauert.
Primäre Defekte können sich zudem in Fehlfunktionen des Immunsystems äußern, d.h. in sogenannten Immundysregulationen. Das betrifft etwa ein Viertel der Patienten. Zu diesen Dysregulationen zählen die Immunthrombozytopenie bei Antikörpermangelsyndrom, aber auch chronisch-granulomatöse Entzündungen von Lunge, Darm und Haut, Hautekzeme sowie Durchfall und Gewichtsabnahme im Rahmen chronisch-entzündlicher Darmerkrankungen. Das Akronym GARFIELD gilt als Merkhilfe für die Warnzeichen der Immundysregulation:
- Granulome
- Autoimmunität
- Rezidivierendes FIeber
- Ekzeme
- Lymphoproliferation
- chronische Darmentzündung
Neben den Beschwerden gibt oft die Familienanamnese Hinweise auf einen primären Immundefekt. So z.B., wenn Eltern oder Großeltern häufig an Infekten litten, wiederholt Antibiotika benötigten oder in der Familie schwerwiegende Infektionen oder Todesfälle im Kindesalter bekannt sind.
Als Basisdiagnostik gelten Differenzialblutbild und Blutausstrich sowie die quantitative Bestimmung der Immunglobuline inklusive IgG-Subklassen. Pathologische Werte der Immunglobuline sind nach einigen Monaten zu kontrollieren. Bleiben die Auffälligkeiten, sollte Kontakt zu einem Immundefektzentrum aufgenommen werden. Dort erfolgt die weitere Diagnostik, z. B. die Analyse des Komplementsystems und, wenn erforderlich, eine molekulargenetische Untersuchung.
Zum Ausschluss maligner Ursachen dienen Serum- und Urinelektrophorese. Eventuell ist ein HIV-Test sinnvoll. Da dieser bei Antikörpermangelsyndrom falsch negativ ausfallen kann, muss das Virus mittels Antigennachweis oder einem Nukleinsäureamplifikationstest nachgewiesen werden.
Allgemeine Hygienemaßnahmen bilden die Basis der Therapie, egal welcher Immundefekt vorliegt. Das heißt unter anderem: Meiden von Menschenansammlungen, regelmäßige Händehygiene sowie eine penible Haut- und Zahnpflege. Die Patienten sollten alle erforderlichen Impfungen erhalten. Für primären oder sekundären Immundefekt hat die Ständige Impfkomission entsprechende Empfehlungen herausgegeben. Ob Betroffene eine primär- oder sekundärprophylaktische antimikrobielle oder -virale Therapie brauchen, muss man im Einzellfall entscheiden. Stand-by-Antibiotika, die sie im Fall einer Infektion selbstständig einnehmen, können helfen, schwere Verläufe zu vermeiden.
Immunsuppressive Substanzen inklusive Biologika sind bei Immundysregulationen angezeigt, einige primäre Immundefekte sprechen auf eine Stammzelltransplantation an. Bei Antikörpermangelsyndromen kommen Immunglobuline s.c. oder i.v. zum Einsatz. Als gesicherte Indikation nennen die Autoren beispielsweise die Agammaglobulinämie mit < 2 g/l IgG im Serum und < 2 % reifen B-Zellen im peripheren Blut oder das variable Immundefektsyndrom. In Fällen von sekundärem Antikörpermangel empfehlen die Experten zunächst eine antimikrobielle Prophylaxe. Greift diese nicht, ist bei signifikanter Hypogammaglobulinämie (z.B. < 4 g/l) oder pathologischer Impfantwort ebenfalls die Immunglobulinsubstitution zu erwägen.
Quelle: August D, Grimbacher B. internistische praxis 2021; 63: 559-569
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).