
Leitlinie lotst durch die komplexe Klinik der seltenen Lebererkrankungen
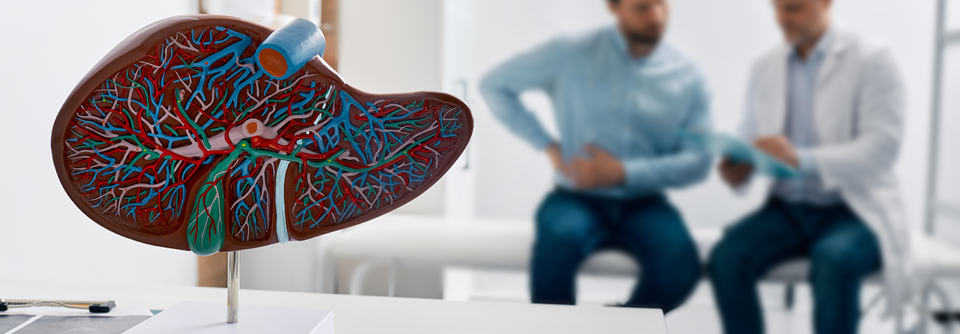 Mit einer Leberbiopsie wird die Diagnose Autoimmunhepatitis – hier bereits mit fibrotischem Gewebe (bläulich) – abgesichert.
© Peakstock – stock.adobe.com
Mit einer Leberbiopsie wird die Diagnose Autoimmunhepatitis – hier bereits mit fibrotischem Gewebe (bläulich) – abgesichert.
© Peakstock – stock.adobe.com
Eine neue Leitlinie lotst durch die diffizile klinische Situation der seltenen Lebererkrankungen. Wie grenzen sich primär sklerosierende und primär biliäre Cholangitis voneinander ab und wie bewältigt man die individuellen Verläufe der Autoimmunhepatitis?
Mit autoimmuner Hepatitis und primär sklerosierender Cholangitis muss man schon bei kleinen Kindern und Jugendlichen rechnen. Die primär biliäre Cholangitis beginnt dagegen fast immer erst im Erwachsenenalter. Die autoimmune Hepatitis ist die vielfältigste Form. Ihr Spektrum reicht von asymptomatischen leichten Leberwerterhöhungen bis zum akuten Organversagen. Auch das therapeutische Ansprechen fällt sehr unterschiedlich aus: In einem Fall gelingt eine rasche Remission und die Erkrankten kommen danach mit einer steroidfreien Monotherapie zurecht. Andere benötigen eine Lebertransplantation, weil sogar die Drittlinienbehandlung scheitert.
Bei klinischem Verdacht auf die autoimmune Hepatitis wird in der S3-Leitlinie der DGVS* und weiteren Fachgesellschaften primär zu einer Kontrolle des IgG-Spiegels geraten. Zudem sollen Autoantikörper gegen Zellkerne (ANA), glatte Muskulatur (SMA/Aktin) und gegen lösliches Leberantigen und Leber-Pankreas-Antigen (SLA/LP) bestimmt werden. Zur Sicherung der Diagnose ist eine Leberbiopsie indiziert – unabhängig vom Lebensalter der oder des Erkrankten.
Die Detektion von Autoantikörpern genügt nicht zum Nachweis. Bei Erwachsenen mit autoimmuner Lebererkrankung ermöglicht die transiente Elastografie eine Differenzierung zwischen frühem und fortgeschrittenem Stadium und erlaubt Rückschlüsse auf die Prognose.
Therapeutisch geht es darum, die Progression der autoimmunen Hepatitis (Zirrhose, Leberversagen, Transplantationsbedarf) zu verhindern. Dem dienen zwei Ziele: Induktion und Erhalt einer kompletten Remission. Wenn innerhalb eines halben Jahres keine vollständige laborchemische Rückbildung gelingt, sollte die Diagnose autoimmune Hepatitis und die Therapietreue überprüft werden. Zum Erreichen der Remission eignet sich am besten ein Glukokortikoid. Für Erwachsene genügt in der Regel eine Prednisolon-Tagesdosis von ≤ 0,5 mg/kg. Um steroidale Nebenwirkungen zu vermeiden, ist mittel- und langfristig eine Monotherapie mit Azathioprin anzustreben.
Die zweite wichtige Diagnose ist die primär biliäre Cholangitis. Das Autorenteam der Leitlinie weist darauf hin, dass sie nicht nur bei älteren Frauen auftritt, sondern auch bei jüngeren (30–40 Jahre) und Männern. Die Diagnose primär biliäre Cholangitis wird gestellt, wenn mindestens zwei der drei folgenden Kriterien vorliegen:
- erhöhte Cholestasewerte (v. a. alkalische Phosphatase),
- antinukleäre oder antimitochondriale Antikörper, besonders AMA-M2, und
- typische Histologie mit chronischer, nichteitriger, destruierender Cholangitis.
Als Standardtherapie sollen die Betroffenen lebenslang Ursodeoxycholsäure (UDCA) einnehmen (13–15 mg/kg/d). Gegen den Juckreiz kann zusätzlich Colestyramin verabreicht werden, im Abstand von zwei bis vier Stunden zu UDCA. Alternativ kommt Bezafibrat (off-label) in Betracht.
Hinter dauerhaft erhöhten Cholestaseparametern kann sich eine primär sklerosierende Cholangitis verbergen. Die Abklärung gelingt am besten mit einer Magnetresonanz-Cholangiopankreatikografie. Interventionelle Behandlung der ersten Wahl ist die Ballondilatation (ggf. nach Bougierung). Bei unzureichendem Ansprechen kann kurzzeitig ein Stent eingelegt werden (< 6 Wochen). Zur medikamentösen Therapie bei Juckreiz eignet sich bei erwachsenen Betroffenen in erster Linie Bezafibrat bzw. Rifampicin.
Patientinnen mit autoimmunen Lebererkrankungen und Kinderwunsch sollten präkonzeptionell hepatologisch beraten werde. Die Schwangerschaft scheint auch bei Frauen mit primär sklerosierender Cholangitis ohne fortgeschrittene Leberfibrose, portale Hypertension oder Komplikationen sicher zu sein. Es gibt also keinen Grund, von einer Gravidität generell abzuraten, so die Leitlinienautorinnen und -autoren. Allerdings muss bei nicht abgeschlossener Familienplanung die immunsuppressive Therapie ggf. modifiziert werden, teratogene Wirkstoffe sind tabu. Die besten Daten liegen für Azathioprin vor, es kann während der gesamten Gravidität und Stillzeit eingenommen werden.
Personen mit Autoimmunhepatitis oder primär biliärer Cholangitis im Stadium der Leberzirrhose, die auf die Standardtherapie nicht ausreichend ansprechen, sollten frühzeitig in einem Transplantationszentrum vorgestellt werden. Für Kinder und Jugendliche gibt es entsprechende pädiatrische Angebote.
*Deutsche Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten
S3-Leitlinie „Seltene Lebererkrankungen (LeiSe LebEr) – autoimmune Lebererkrankungen von der Pädiatrie bis zum Erwachsenenalter“; AWMF-Register-Nr. 021-027; www.awmf.org
Quelle: Medical-Tribune-Bericht
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).


