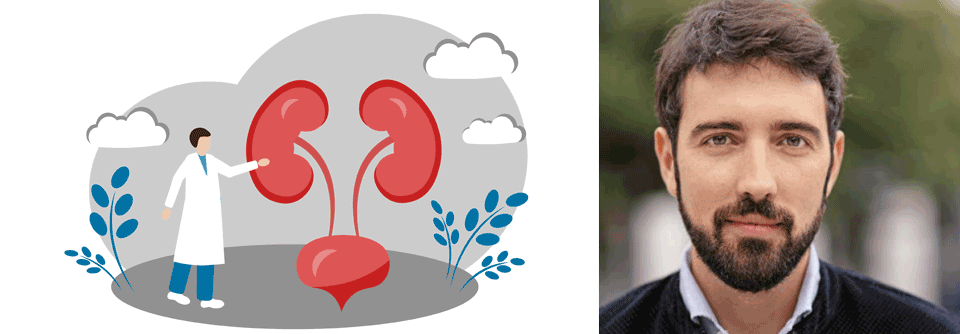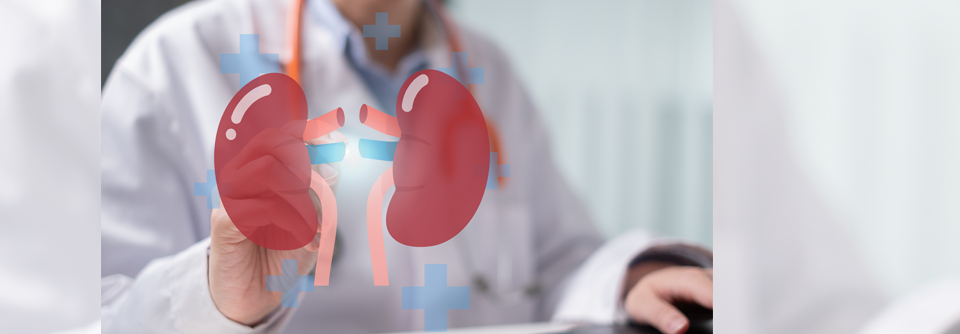
Nephrologie: Neben neuen Therapiemöglichkeiten stehen strukturelle Herausforderungen
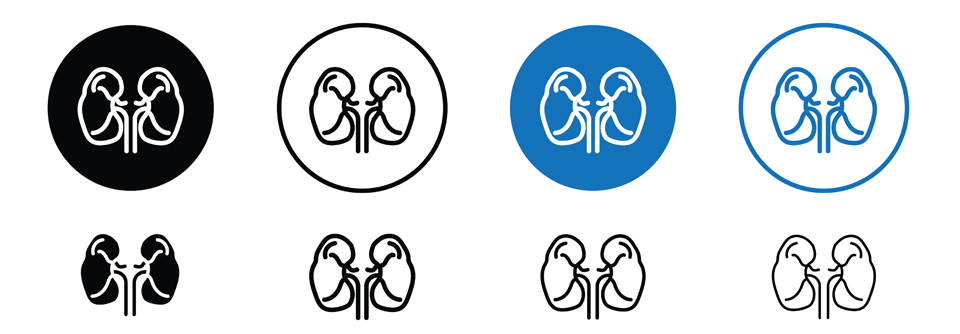 In den vergangenen Jahren gab es große Fortschritte in der Diagnostik und Therapie, so dass auch in der Nephrologie eine immer präzisiere Medizin möglich wird.
© Tysam - stock.adobe.com
In den vergangenen Jahren gab es große Fortschritte in der Diagnostik und Therapie, so dass auch in der Nephrologie eine immer präzisiere Medizin möglich wird.
© Tysam - stock.adobe.com
„Zeitenwende ist hier positiv gemeint“ betonte Professorin Dr. med. Julia Weinmann-Menke, Pressesprecherin der DGfN, während der Kongress-Pressekonferenz der DGfN am 30.9.2025. Auch in den vergangenen fünf Jahren habe es große diagnostische Fortschritte und insbesondere enorme Fortschritte hinsichtlich der therapeutischen Möglichkeiten gegeben. Gleichzeitig steht die Nephrologie vor gravierenden Herausforderungen. Nicht nur der sich in Zukunft vermutlich noch verschärfende Fachkräftemangel ist hier zu nennen, sondern auch eine mögliche Gefährdung der flächendeckenden Versorgung und drohende Unterfinanzierung. Schlaglichtartig beleuchtete die Pressekonferenz einige Bereiche von besonderem Interesse, wie beispielsweise die Früherkennung der CKD, die Bedeutung der neuen S3-Leitlinie für Glomerulonephritiden und der Heimdialyse in Zeiten des Fachkräftemangels sowie die Krankenhausreform, wo Nachbesserungsbedarf bestehe.
CKD: Prävention und Früherkennung
Die chronische Nierenkrankheit (CKD) entwickelt sich zu einer der wichtigsten medizinischen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Von einer CKD sind weltweit bereits etwa 10 bis 15 Prozent der Bevölkerung betroffen und Prognosen zufolge wird sie bis 2040 zu den fünf häufigsten Volkskrankheiten zählen, was die Dringlichkeit präventiver Maßnahmen unterstreicht.
Bluthochdruck und Diabetes zählen weiterhin zu den häufigsten Ursachen für eine CKD; bereits in frühen CKD-Stadien erhöht sich das Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall und andere kardiovaskuläre Komplikationen. Denn im Zusammenspiel von Hypertonie und Nierenfunktionsverlust entsteht oft ein Teufelskreis: „Je schlechter die Nieren funktionieren, desto höher steigt meist der Blutdruck“, erklärt Professorin Dr. med. Julia Weinmann-Menke, Direktorin der Klinik für Nephrologie, Rheumatologie und Nierentransplantation (NTX) am Universitätsklinikum Mainz. „Die konsequente Einnahme von ärztlich verschriebenen Blutdrucksenkern ist daher eine zentrale Säule in der Prävention und Therapie der CKD“, so Weinmann-Menke. In der Prävention ebenso wichtig ist ein gut eingestellter Diabetes mellitus, denn ein über längere Zeit erhöhter Blutzuckerspiegel führt zu Gefäßveränderungen, wobei die kleinen Gefäße der Nieren hier besonders betroffen sind (Mikroangiopathie).
Bei Check-Up nach eGFR und UACR fragen
Die DGfN empfiehlt Risikopatientinnen und -patienten daher dringend, regelmäßig ihre Nierenfunktion überprüfen zu lassen. Dabei spielen die glomeruläre Filtrationsrate (eGFR) und der Albumin-Kreatinin-Quotient (UACR) im Urin eine entscheidende Rolle. Diese Untersuchungen sollten auch im Rahmen des allgemeinen Gesundheits-Checks, der gesetzlich Krankenversicherten ab dem 35. Lebensjahr zusteht, durchgeführt werden.
Leider sei dies nicht im Check-Up vorgesehen, so Weinmann-Menke, deshalb rät sie, nachzufragen.
Neben der medikamentösen Therapie bleibt die Prävention durch Lebensstiländerungen essenziell. Dazu zählen der Verzicht auf Nikotin, eine gesunde Ernährung, regelmäßige Bewegung und die Vermeidung von Übergewicht. Weinmann-Menke weist darauf hin, dass moderne Medikamente wie SGLT2-Hemmer oder nicht-steroidale Mineralokortikoid-Rezeptor-Inhibitoren zwar wirksam bei CKD seien, doch lasse sich durch konsequente Prävention sowie durch regelmäßige Screening-Untersuchungen bei Risikopatienten von vornherein viel Leid vermeiden und Kosten senken.
Fortschritte bei Glomerulonephritiden
Präzisere Diagnosen und Therapien
Glomerulonephritiden (GN) sind mit etwa einem Viertel aller Fälle die häufigste Ursache für ein Nierenversagen. Diese Krankheitsgruppe umfasst eine Vielzahl von primären und sekundären Formen, die oft immunologisch bedingt sind. Die Erkrankungen können rasch zu einem vollständigen Verlust der Nierenfunktion führen, wenn sie nicht rechtzeitig diagnostiziert und behandelt werden. Dank neuer diagnostischer Marker und molekularer Verfahren können Glomerulonephritiden heute wesentlich genauer eingeordnet werden. „Die Behandlung entfernt sich zunehmend von unspezifischer Immunsuppression hin zu gezielten, pathophysiologisch fundierten Ansätzen“, erklärt Prof. Dr. med. Jan J. Menne, Chefarzt der Klinik für Nephrologie Angiologie, Hypertensiologie und Rheumatologie am KRH Klinikum Siloah in Hannover und Tagungspräsident der DGfN 2025.
Neue S3-Leitlinie ist ein Meilenstein
Ein entscheidender Fortschritt in der Versorgung ist die neue S3-Leitlinie „Diagnose und Therapie von Glomerulonephritiden“, die unter Federführung der DGfN erarbeitet wurde. Sie bietet erstmals evidenzbasierte Empfehlungen für die Diagnostik, einschließlich Nierenbiopsien, Labor- und Bildgebungsverfahren sowie für die Basistherapien wie RAS-Inhibitoren und SGLT2-Hemmer. Die Leitlinie enthält zudem spezifische Therapiepfade für häufige und seltene GN-Formen und berücksichtigt auch Kinder und Jugendliche. Patienten werden stärker in Therapieentscheidungen und die Nachsorge eingebunden, was zu einer individualisierten Versorgung beiträgt.
Targeted Therapies
Neue Therapien greifen gezielt in fehlgeleitete Immunprozesse ein, die bisher nur unspezifisch mit Kortison und weiteren Immunsuppressiva unterdrückt wurden. Zahlreiche spezifische Therapieangriffspunkte wurden identifiziert – von B- und T-Lymphozyten über Zytokine bis zum Komplementsystem. Erste sogenannte Targeted Therapies sind bereits verfügbar oder stehen kurz vor der Zulassung. So ersetzen neue Antikörpertherapien (zum Beispiel Rituximab, Obinutuzumab) zunehmend klassische Immunsuppressiva. Komplementinhibitoren wie Iptacopan oder Ravulizumab eröffnen neue Optionen bei seltenen Formen wie der C3-Glomerulopathie. Spezifische Wirkstoffe für IgA-Nephropathie und Lupus-Nephritis (zum Beispiel Budesonid, Sparsentan, Belimumab, Voclosporin) sind zugelassen oder in späten Studienphasen. Auch Komplementfaktoren wie C3, C5 sowie alternative und Lektin-Weg-Komponenten werden als Zielstrukturen getestet: „Erste Ergebnisse stimmen zuversichtlich“, sagt Professor Menne. Sogar neuartige Ansätze wie die CAR-T-Zelltherapie – bislang vor allem aus der Onkologie bekannt – werden zur Eliminierung autoimmun aktiver B-Zellen bei Lupus-Nephritis untersucht.
„Diese Vielfalt an Therapien ist vor allem für Patientinnen und Patienten wichtig, die auf herkömmliche Behandlungen nicht ausreichend ansprechen“, betont Menne. „Eine GN kann man zwar noch nicht endgültig heilen. Aber wir können sie heute in vielen Fällen weitgehend zum Stillstand bringen“, so der Nephrologe. „Die neuen Therapien und die Leitlinie setzen Maßstäbe für eine moderne, individualisierte Versorgung.“
Forschung und Versorgung verzahnen
Die DGfN fordert, dass neue wissenschaftliche Erkenntnisse schneller in die Praxis gelangen. „Wir brauchen ein Deutsches Zentrum für Nierengesundheit, um Erkenntnisse zu bündeln und die Versorgung nachhaltig zu verbessern“, erläutert die Generalsekretärin der DGfN, Dr. med. Nicole Helmbold.
Fachkräftemangel in der Nephrologie: Potenzial der Heimdialyse mehr nutzen
Flexibel, alltagsnah, medizinisch sinnvoll
In Deutschland sind etwa 100.000 Menschen auf eine regelmäßige Dialyse angewiesen, doch nur 7 % nutzen die Möglichkeit der Heimdialyse. „Wir sehen im Ausbau der Heimdialyse eine Chance, die Versorgung langfristig zu sichern, Patientinnen und Patienten mehr Selbstbestimmung und Wohlbefinden zu ermöglichen und gleichzeitig das medizinische Personal zu entlasten“, sagt Prof. Dr. Martin Kuhlmann, Präsident der DGfN. Die DGfN hält eine Quote von 20 bis 30 Prozent, wie sie in anderen Ländern erreicht wird, auch in Deutschland für realistisch.
Die Heimdialyse bietet zahlreiche Vorteile. Sie ermöglicht eine flexible Zeitgestaltung, den Wegfall langer Anfahrtswege und eine bessere Nachahmung der natürlichen Nierenfunktion durch häufigere und kontinuierlichere Dialysebehandlungen. „Je häufiger und kontinuierlicher dialysiert wird, desto besser wird die natürliche Nierenfunktion ersetzt“, erläutert Kuhlmann, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin – Nephrologie am Vivantes Klinikum im Friedrichshain in Berlin. „Für berufstätige, aber auch für alle selbstständigen oder von der Familie unterstützten Betroffenen kann die Heimdialyse eine attraktive Option sein, die gleichzeitig auch eine erhebliche Verbesserung der Lebensqualität darstellt.“
Die Voraussetzungen für die Anwendung der Heimdialyse umfassen eine sorgfältige Schulung der Patientinnen und Patienten sowie der behandelnden Ärztinnen und Ärzte. Zudem ist die Bereitschaft und Eignung zur selbstständigen Durchführung der Heimdialyse erforderlich. Ambulante und stationäre Dialyseeinrichtungen stellen an dieser Stelle ein verlässliches Backup für medizinische Rückfragen dar.
Gesundheitspolitisches Momentum nutzen - Heimdialyse strukturell verankern
Die DGfN begrüßt die neuen finanziellen Anreize, die ab 2025 geschaffen wurden, um die Heimdialyse zu fördern. Leistungserbringer erhalten für die ersten 52 Behandlungswochen wöchentliche Zuschläge in Höhe von 96,50 Euro. „Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um die Heimdialyse strukturell zu verankern“, betont Kuhlmann. Die DGfN fordert, dass nephrologische Versorgungswege neu gedacht werden – vom Zeitpunkt der Diagnose an. Auch international engagiert sich die DGfN für die Heimdialyse, etwa im Rahmen des International Home Dialysis Consortium (IHDC), das Fachgesellschaften, medizinisches Personal, Patientenorganisationen und politische Entscheidungsträger zusammenbringt.
Krankenhausreform: Gefährdung der flächendeckenden Versorgung
Die DGfN warnt vor einer Gefährdung der flächendeckenden Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Nierenkrankheiten durch die geplante Krankenhausreform. Denn das künftige Vorhaltevolumen für die komplexe nephrologische Versorgung wird auf Basis der Abrechnungsdaten von 2023/2024 berechnet. Diese bilden den tatsächlichen nephrologischen Versorgungsumfang jedoch nicht ausreichend ab. Denn aufgrund länderspezifischer Besonderheiten in der Abrechnung wurde die erbrachte nephrologische Versorgung oftmals der Leistungsgruppe „Allgemeine Innere Medizin“ zugeordnet, statt sie in der Leistungsgruppe „Komplexe Nephrologie“ zu verbuchen. In der Folge müssten sich je Bundesland mehr Krankenhäuser ein zu kleines nephrologisches Budget teilen. Dies gefährdet nicht nur die flächendeckende Versorgung, sondern auch die ärztliche Weiterbildung in der Nephrologie. In ihrer aktuellen Stellungnahme fordert die DGfN Politik und Planungsbehörden deshalb auf, die Leistungsgruppe „Komplexe Nephrologie“ sachgerecht auszustatten und in der Planung angemessen zu berücksichtigen [1]. Die Reform muss sicherstellen, dass komplexe nephrologische Leistungen angemessen finanziert werden und somit für Krankenhäuser attraktiv bleiben.
Nephrologische Patienten brauchen mehr als allgemeine Innere Medizin
Unter den internistischen Fachgebieten weisen Patientinnen und Patienten in nephrologischen Kliniken eine besondere Krankheitskomplexität auf. Das Behandlungsspektrum der Nephrologie umfasst neben schweren Nierenkrankheiten und lebenserhaltenden Nierenersatztherapien auch die Vorbereitung und Nachsorge von Nierentransplantationen sowie Störungen des Wasser-, Elektrolyt- und Säure-Basen-Haushalts und schwer einstellbare Formen der Hypertonie. „Die Versorgung setzt tiefgreifende Kenntnisse der Zusammenhänge voraus. Sie kann nicht hilfsweise durch andere Fachrichtungen oder die allgemeine Innere Medizin übernommen werden, ohne dass die Behandlungsqualität leidet. Und diese zu verbessern, ist ein zentrales Ziel der Krankenhausreform“, so Dr. med. Nicole Helmbold, Generalsekretärin der DGfN. Die DGfN fordert deshalb, dass alle nephrologischen Kliniken und Abteilungen erhalten bleiben und ausreichend finanziert werden.
DGfN fordert politische Nachsteuerung zur Sicherung der nephrologischen Versorgung
Die DGfN fordert die Politik auf, die Besonderheiten der Nephrologie zu berücksichtigen und eine flächendeckende Versorgung sowie eine nachhaltige ärztliche Weiterbildung zu sichern. Die aktuelle Systematik des Leistungsgruppen-Groupers und die Bezugsjahre für die Vorhaltevolumina führe zu einer Benachteiligung nephrologischer Einrichtungen - und damit der oft schwer kranken Patientinnen und Patienten. Dies könnte auch andere Leistungsgruppen gefährden, die auf die Nephrologie aufbauen, etwa die Nierentransplantation. „Wir fordern deshalb dringend eine Anpassung, um die Versorgungssicherheit, Finanzierungsgerechtigkeit und Weiterbildungsmöglichkeiten zu erhalten“, so Helmbold. Aus Sicht der DGfN gehört dazu eine transparente und laufende Evaluation der Planungsinstrumente, insbesondere des Leistungsgruppen-Groupers des Instituts für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK). Bisher fehlt in der Gesetzesbegründung des KHAG jedoch ein konkreter Hinweis darauf, dass der Leistungsgruppen-Grouper und seine Wirkung selbst evaluiert werden sollen.
„Im Sinne einer guten Patientenversorgung müssen jetzt die Weichen durch die Politik gestellt und weitere Anpassungen an der Krankenhausreform vorgenommen werden“, betont Helmbold, damit eine auskömmliche Finanzierung und Ausgestaltung der Leistungsgruppe „Komplexe Nephrologie“ sichergestellt sein könne.
[1] Stellungnahme der DGfN:
Stellungnahme zum Referentenentwurf zum Gesetz zur Anpassung der Krankenhausreform (Krankenhausreformanpassungsgesetz – KHAG)
Quelle: 17. Jahrestagung der DGfN
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).