
Präzisionsmedizin eröffnet Chancen bei ATTR-Kardiomyopathie
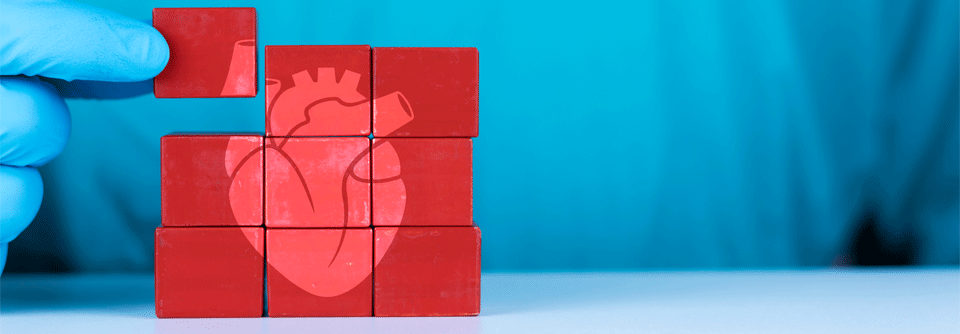 Was einst als seltene Erkrankung mit verheerender Prognose galt, ist heute ein relativ verbreitetes Leiden, das sich spezifisch therapieren lässt.
© Tom - stock.adobe.com
Was einst als seltene Erkrankung mit verheerender Prognose galt, ist heute ein relativ verbreitetes Leiden, das sich spezifisch therapieren lässt.
© Tom - stock.adobe.com
Zwar handelt es sich bei der Transthyretin-Amyloidose um eine systemische Krankheit, doch Morbidität und Mortalität werden hauptsächlich durch die Herzbeteiligung bestimmt. Die Kardiomyopathie resultiert aus der extrazellulären Ablagerung von Transthyretin (TTR) und verläuft progredient. Für Kardiologinnen und Kardiologen stellt sie bei Weitem keine seltene Erkrankung mehr dar, betont ein Team um Dr. Esther Gonzalez-Lopez vom Universitätsklinikum Madrid in einem State-of-the-Art-Review.
Eine Metaanalyse von Screening-Studien ergab, dass 12 % der HFpEF*-Betroffenen, 10–15 % der Älteren mit schwerer Aortenstenose und 7 % derjenigen mit einer linksventrikulären Wanddicke ≥ 15 mm eine Transthyretin-Amyloidose mit Kardiomyopathie (ATTR-CM) aufweisen. Auch bei HFrEF** oder Reizleitungsstörungen scheint sie häufiger vorzukommen als gedacht.
Die Lebenserwartung betrug lange Zeit nur 2,5–3,5 Jahre. Mittlerweile hat sie sich u. a. aufgrund früherer Diagnosestellung und spezifischer Behandlungen verbessert. Produktionshemmende, stabilisierende und abbaufördernde Substanzen setzen an verschiedenen Punkten der sogenannten amyloidogenen Kaskade an. Dieser Prozess beschreibt die Entstehung von Amyloidfibrillen aus instabilen TTR-Molekülen. Die Kaskade scheint nach aktuellem Wissensstand bei hereditärer (hATTR) und Wildtyp-Amyloidose (ATTRwt) ähnlich abzulaufen. Eingesetzt bzw. untersucht werden folgende Präparate:
TTR-Stabilisatoren verhindern den Abbau der zirkulierenden Tetramere in Di- und Monomere, sodass es gar nicht erst zu fehlgefalteten Proteinen kommen kann. Zu dieser Wirkstoffgruppe zählen Diflunisal, Tafamidis und Acoramidis. Die beiden Letzteren sind bei ATTR-CM zugelassen. Real-World-Daten zu Tafamidis zeigen ein Hinauszögern von herzinsuffizienzbedingten Hospitalisierungen, Herztransplantationen sowie Todesfällen. Allerdings gibt es aktuell Bedenken bzgl. einer Interaktion mit Statinen, so das Autorenteam.
Acoramidis konnte in der Zulassungsstudie ATTRibute-CM ebenfalls überzeugen. Insbesondere die Zahl der Klinikeinweisungen sank gegenüber Placebo deutlich– bei ähnlichem Nebenwirkungsprofil. Vergleichen lassen sich die beiden Stabilisatoren derzeit jedoch schwer, da sich die Einschlusskriterien in den jeweiligen Analysen unterschieden.
TTR-Suppressoren zielen darauf ab, die Transthyretin-Produktion in der Leber zu blockieren und die Serumlevel zu reduzieren. Dies gelingt durch „gene silencing“ und „gene editing“. Die Silencer lassen sich wiederum unterteilen in small interfering (si) RNAs und Antisense-Oligonukleotide (ASO). Vier solcher Präparate sind mittlerweile zur Therapie der hATTR mit Polyneuropathie zugelassen. Sie scheinen aber auch bei kardialer Beteiligung effektiv zu sein.
Die siRNA Patisiran und das ASO Inotersen zählen zu den TTR-Gen-Silencern der ersten Generation. Positive Daten zum Einsatz von Patisiran bei ATTR-CM (Wildtyp oder hereditär) lieferte die zwölfmonatige Phase-3-Studie APOLLO-B. Ob kardiovaskuläre Endpunkte wie die Mortalität günstig beeinflusst werden, muss ein längeres Follow-up zeigen. Zum kardialen Effekt von Inotersen liegt nur eine kleine nicht randomisierte Studie vor. Allerdings geht das Autorenteam davon aus, dass der Wirkstoff langfristig nicht mehr gebraucht wird, da Gen-Silencer der zweiten Generation ein deutlich besseres Nebenwirkungsprofil aufweisen. Zudem führen sie zu einer stärkeren Senkung des Transthyretin-Serumspiegels.
Die neueren Substanzen heißen Vutrisiran und Eplontersen. Im Gegensatz zu Patisiran ist bei der weiterentwickelten siRNA keine Prämedikation erforderlich. Und im Vergleich zu Placebo ergab sich in der HELIOS-B-Studie zur ATTR-CM ein Vorteil für Vutrisiran (40 % der Patientinnen und Patienten nahmen zu Beginn bereits Tafamidis ein). Mit dem ASO Eplontersen läuft die derzeit größte Studie zur ATTR-CM. Sie umfasst 1.443 Betroffene. Die Ergebnisse werden Mitte 2026 erwartet. In der Rekrutierungsphase befindet sich zudem eine klinische Phase-3-Studie zu Nexiguran Ziclumeran, einer CRISPR-/Cas9-basierten Gen-Editing-Therapie.
Sogenannte Remover fördern die Eliminierung der Amyloidfibrillen. Lange Zeit ging man davon aus, dass diese gar nicht löslich oder abbaubar seien. Am weitesten fortgeschritten ist die Forschung zum rekombinanten humanen Antikörper ALXN2220. Dessen Bindung an die fehlgefalteten TTR-Oligomere und aggregierten Fibrillen sorgt für eine Aktivierung von Phagozyten. In einer Phase-1-Untersuchung nahmen das extrazelluläre Volumen im Herzmuskel sowie die NT-proBNP-Spiegel unter der Therapie ab. Für die Phase-3-Studie DepleTTR-CM werden aktuell Patientinnen und Patienten mit kardialer Transthyretin-Amyloidose rekrutiert.
Mit der Vielzahl an Wirkstoffen und dem besseren Verständnis der Pathophysiologie stellen sich neue Fragen: Welche Rolle spielen Kombinationsbehandlungen? Wann sollte man auf ein anderes Präparat wechseln oder die Therapie beenden? Und wie verhält es sich mit der Langzeitsicherheit unter einer TTR-Depletion? Diese und weitere Themen müssen künftige Untersuchungen adressieren.
*heart failure with preserved ejection fraction
** heart failure with reduced ejection fraction
Quelle: Gonzalez-Lopez E et al. Eur Heart J 2024; doi: 10.1093/eurheartj/ehae811
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).


