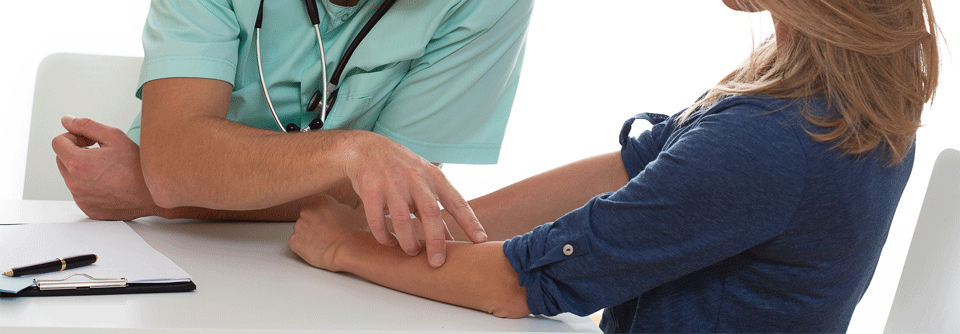Cartoon Interview
Wie Ärztinnen subtilen Machtspielen im Klinikalltag ausgesetzt sind – und wie sie sich wehren können
 Wer klare und freundliche Grenzen setzt, ist nicht „humorlos und bockig“, sondern kann sich auf die medizinische Arbeit und die eigene Karriere konzentrieren.
© SneakyPeakPoints/peopleimages.com – stock.adobe.com
Wer klare und freundliche Grenzen setzt, ist nicht „humorlos und bockig“, sondern kann sich auf die medizinische Arbeit und die eigene Karriere konzentrieren.
© SneakyPeakPoints/peopleimages.com – stock.adobe.com
Liebe Frau Dr. Palazzo – Sie geben Kommunikations-Aikido-Kurse für Assistenzärztinnen an einer Schweizer Klinik. Was ist da los an der Klinik?
Oh, das Problem ist keineswegs ein spezifisches der Uni St. Gallen. In Krankenhäusern als Frau zu bestehen ist nirgendwo wirklich leicht, es gibt viele subtile Hindernisse. Für Assistenzärztinnen ist das oft wahnsinnig anstrengend. Ich versuche, ihnen Rüstzeug zu geben, um ihnen ihren Weg etwas leichter zu machen.
Mal ehrlich: Brauchen Frauen solche Kurse wirklich? Oder ist da auch viel Aufregung um Lappalien?
Ernsthaft? Frauen lassen sich viel zu viel gefallen. Es gibt diesen sogenannten modernen Sexismus – subtil, oft kaum greifbar. Kleine Spitzen, abwertende Kommentare oder Fragen, die Energie rauben. Und genau darin liegt das Miese: Diese Energie, die Frauen aufbringen müssen, um damit umzugehen, können Männer direkt in ihre Karriere stecken!
Beschreiben Sie uns doch mal eine typische Situation.
Ach, es gibt so viele! Aber gerade aus dem OP hört man z.B. von Sprüchen, wie etwa der Chefarzt, der der jungen Ärztin zuzwinkert und sagt: „Sie werden sehen, Chirurgie ist wie Sex – auf das Tempo kommt es an!“ Oder noch mal anders, aber auch ans Geschlecht gebunden: Die Patientin bittet die junge Ärztin, sie mal eben zur Toilette zu begleiten. Die meisten Frauen machen es einfach – und verschenken wieder eine Viertelstunde, die sie nicht in ihre medizinische Arbeit investieren können. Ihre männlichen Kollegen werden das nie gefragt. Das Gleiche gilt fürs Protokollschreiben oder andere Kannst-du-mal-eben-Gefälligkeiten. Es scheinen Kleinigkeiten zu sein. Aber es summiert sich.
Und was raten Sie den Ärztinnen? Einfach Nein sagen?
Es geht um klare, aber freundliche Grenzen. Aber das ist nicht einfach. Wir sind nicht darauf vorbereitet, solche Situationen souverän zu lösen. Viele Frauen reagieren mit einem Lächeln, sagen gar nichts oder legen den Kopf schief. Das signalisiert dem Gegenüber: „Es geht durch.“ Und dann macht er es einfach wieder. Deswegen ist es gut, vorbereitet zu sein.
Was lernen die Teilnehmerinnen in Ihrem Kurs konkret?
Zunächst machen wir uns bewusst: Es liegt nicht an uns. Es hat nichts mit der roten Bluse oder zu viel Freundlichkeit zu tun. Es ist ein Machtmittel. Ist das geklärt, können wir Techniken üben, um verbal Grenzen zu setzen. Ein Standardwerkzeug ist die Gegenfrage. Wenn jemand sagt: „Wann kommt der Herr Doktor?“, kann man antworten: „Glauben Sie, dass nur Männer Medizin studieren?“ Das dreht die Energie um.
Damit riskieren Frauen aber, als zickig oder humorlos zu gelten.
Natürlich. Frauen bewegen sich oft in einem sehr engen Korridor: Sagen sie nichts, sind sie das Häschen. Reagieren sie klar, gelten sie als schwierig. Dieses sogenannte Hillary-Clinton-Phänomen ist gut erforscht. Deshalb funktioniert unsere Abwehr wie Aikido: Die Energie des Angreifenden wird nicht blockiert, sondern umgeleitet. Statt zu kontern und eine Eskalation zu riskieren, trete ich zur Seite, stelle eine Gegenfrage, schweige demonstrativ oder setze einen humorvollen Konter. So entsteht Umdenken statt Konfrontation, die mich auch nur wieder Energie kostet.
Aber reicht Kommunikation, um etwas richtig zu verändern?
Sicher nicht. Frauen können sich noch so sehr anstrengen – das System ist nicht für sie gebaut. Stattdessen müssen die Organisationen ihre Kultur ändern. Will man die vielen Potenziale kluger und leistungsfähiger Frauen nicht verlieren, braucht es andere Gesprächskulturen, transparente Beförderungskriterien und anonymisierte Bewerbungen. Es braucht ein umfassendes System aus Prävention, Intervention und Unterstützung. Und die Organisationen müssen dafür einstehen, dass Vielfalt die Qualität verbessert– nicht nur die Gerechtigkeit.
Was sind Ihre eigenen Erfahrungen mit Alltagssexismus?
Oh, da sind einige. Die Unangenehmste war: schlüpfrige Bemerkungen meines Chefs im Beisein seines Chefs. Niemand hat etwas gesagt – dieses Alleinsein: Das war schlimm. Ein anderes Mal bot mir ein älterer Professor eine besser bezahlte Promotionsstelle an – unter der Bedingung, dass ich seine Geliebte werde. Ich habe abgelehnt (lacht). Damals, in den 1990ern, wäre ich nie auf die Idee gekommen, das zu melden. Wie schön, dass sich da was verändert hat!
Werden wir irgendwann eine wirklich gleichberechtigte Gesellschaft erreichen?
Ich denke, wir sind an einem Wendepunkt. Der aktuelle Backlash ist meiner Meinung nach das letzte Aufbäumen des Patriarchats. Aber: Gleichberechtigung kommt auf jeden Fall nicht von allein. Wir müssen dranbleiben! Frauen dürfen nicht länger versuchen, einfach nur „nett“ durchzukommen, sie müssen sich gegenseitig unterstützen. Und Männer müssen verstehen, dass Gleichstellung auch ihnen nützt.
Warum fällt Männern eigentlich der Perspektivwechsel so schwer?
Ganz einfach: Es ist schmerzhaft einzusehen, dass der eigene Erfolg auch mit den Privilegien zu tun hat, die man als Mann nun mal hat. Aber genau das Einsehen ist nötig.
Bleibt die Frage: Was ist Ihr wichtigster Rat für junge Ärztinnen?
Lasst euch bloß nicht einreden, dass ihr humorlos seid. Setzt klare Grenzen. Sucht Verbündete – Männer und Frauen. Und übt die kleinen Reaktionen ein, die euch eure Handlungsmacht in übergriffigen Situationen zurückgeben.
Mehr zum O-Ton Onkologie
In O-Ton Onkologie wird alles diskutiert, was mit Krebs zu tun hat: Wir berichten von Neuigkeiten aus Diagnostik und Therapie, stellen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vor oder diskutieren praxisrelevante News von ausgewählten Kongressen. Den Podcast gibt es alle 14 Tage mittwochs auf den gängigen Podcast-Plattformen.
Quelle: Medical-Tribune-Bericht
aktualisiert am 12.08.2025 um 14.41 Uhr
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).