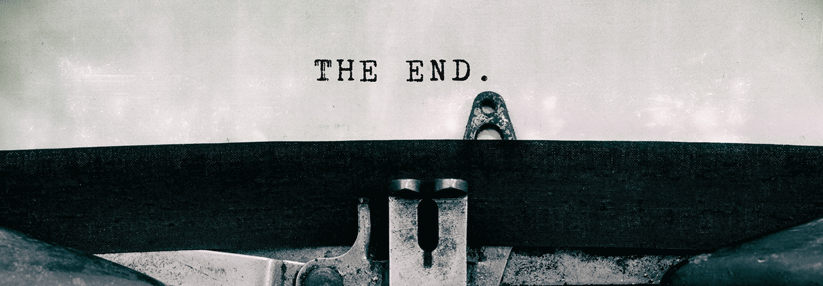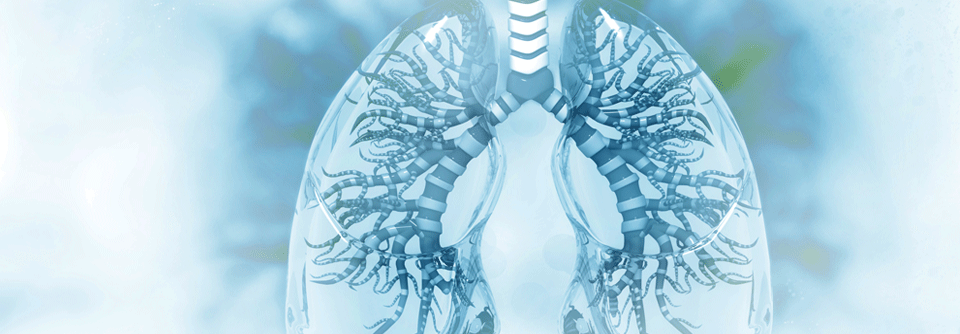
Cartoon Gesundheitspolitik
Wie hat die Palliativversorgung in Deutschland ihren Weg in die Versorgung gefunden?
 An ihre Grenzen kommen die Teams auch, wenn organisch schwere Komplikationen drohen, z. B. bei starker Blutungsgefahr.
© pikselstock - stock.adobe.com
An ihre Grenzen kommen die Teams auch, wenn organisch schwere Komplikationen drohen, z. B. bei starker Blutungsgefahr.
© pikselstock - stock.adobe.com
Es war der Anfang der 2000er, als die Gesundheitsministerin der rot-grünen Koalition Ulla Schmidt die Integrierte Versorgung einführte und damit die Möglichkeit eröffnete, Versorgung ohne Beteiligung der Kassenärztlichen Vereinigungen zwischen Leistungserbringern und Krankenkasse auszuhandeln. Damit brach sie nicht nur mit einer gesundheitspolitischen Tradition, sondern auch der Palliativversorgung Bahn.
Zwar wurde schon seit den 1970ern die Versorgung Sterbender immer wieder und auch emotional diskutiert. Doch erst nach dieser Weichenstellung konnte Dr. Thomas Nolte, Schmerzmediziner aus Wiesbaden, mit einem starken Palliativ- und Hospiznetz im Rücken,
Pass für den Palliativ-Notfall
Damit schwerstkranke Patientinnen und Patienten in einer Notfallsituation nicht gegen ihren Willen medizinischen Maßnahmen ausgesetzt sind, wurde in Wiesbaden 2014 der Palliativpass eingeführt. Er enthält die Wünsche für den Notfall: Ob wiederbelebt und beatmet werden soll und ob die Person zur Behandlung ins Krankenhaus möchte. Vor der Ausstellung muss sich die Person beraten lassen.
im Jahr 2005 mit der Techniker Krankenkasse einen allerersten Palliativversorgungsvertrag für Wiesbaden und Fulda abschließen. Der Inhalt: Gesamthonorare pro Zeiteinheit, damals zehn Tage, und ein Medikamentenbudget. Im Februar 2006 konnte auf dieser Grundlage aus dem Hospiz- und Palliativnetz heraus mit der Integrierten Ambulanten Palliativversorgung begonnen werden, vorerst nur mit einer Handvoll von Leuten. In diesem Zuge gründete sich das Zentrum für ambulante Palliativversorgung (ZAPV).
Fachverband übernimmt die Verhandlungen mit Kassen
2007 dann der nächste entscheidende Schritt: Der bundesweit einheitliche Anspruch für alle Schwerstkranken und Sterbenden auf eine spezialisierte Palliativversorgung wurde im SGB V verankert, wiederum durch das Engagement der damaligen Gesundheitsministerin Schmidt. Im gleichen Jahr bildete sich auch der Fachverband SAPV Hessen in Wiesbaden, der ab dann die Verhandlungen für die SAPV (s. Kasten unten) mit den Kassen übernehmen konnte.
Bis zum Jahr 2009 ließen sich in Hessen schon zehn Standorte aufbauen und auch bundesweit kamen immer mehr SAPV-Verträge mit den Krankenkassen zustande. In Wiesbaden und Umgebung betreute das Team damals 250 Patientinnen und Patienten.
Seitdem ist der Bedarf stetig angewachsen, 2024 befanden sich in der Region 1.550 Menschen in der Versorgung, berichtet Katrin Staab-Martini, Diplom-Pflegewirtin und Geschäftsführerin des ZAPV. Durchschnittlich dauert die Betreuung der Schwerstkranken 20 Tage, das Prinzip der Abrechnung über Zeiteinheiten ist geblieben. In Hessen gibt es heute 29 SAPV-Teams, darunter drei pädiatrische. Das ZAPV in Wiesbaden hat 43 Mitarbeitende, davon sind acht Ärztinnen und Ärzte, 22 Pflegekräfte und 13 Beschäftigte im administrativen Sektor.
Das ärztliche Personal kommt überwiegend aus dem anästhesiologischen und internistischen Bereich. Zu Beginn wurden fast ausschließlich onkologische Fälle an die SAPV übergeben. Heute machen sie noch etwa die Hälfte aus, der Rest sind Schwerst- und Todkranke aus anderen Disziplinen, z. B. der Neurologie. Das passt zum Handlungsauftrag des Teams: „Wir arbeiten symptom- und nicht indikationsgetriggert“,
erklärt Dr. Nolte, erster Vorsitzender des HospizPalliativNetzes Wiesbaden und Umgebung.
Ziel wäre die frühe Integration der Teams bei Schwerkranken, doch das klappt oft nicht wie gewünscht. „Das Wort ‚palliativ‘ passt nicht zum Bewusstsein kurativ tätiger Ärzte, solange noch irgendeine Hoffnung besteht“, sagt Dr. Nolte. Dabei geht es oft zunächst um eine umfassende Beratung der Betroffenen und noch nicht um Therapie am Lebensende. „Wir kümmern uns um all das, womit andere Schwierigkeiten und Probleme haben; dann sind wir oft der gesuchte Ansprechpartner“.
Hausarztpraxen werden immer einbezogen
Die anschließende Zusammenarbeit mit Hausärztinnen und -ärzten hat sich aber über die Jahre verbessert. Wurden die Teams früher eher als Konkurrenz gesehen, weiß gerade die jüngere Generation der Primärversorgenden die Unterstützung sehr zu schätzen. Schließlich bleiben Hausärztinnen und -ärzte auch weiterhin einbezogen, kümmern sich z.B. um vorbestehende Erkrankungen und können zudem an vielen Situationen digital teilnehmen. Was das Ausmaß der Interventionen angeht, gibt es nach der Genehmigung der SAPV durch die Krankenkassen nur noch wenige Einschränkungen. Allerdings geht es auch kaum um kostspielige apparative Maßnahmen. „Wir arbeiten mit low tech, aber high personal input“, beschreibt Dr. Nolte das Konzept.
Psychologische Hilfe fehlt im Team leider noch
Sprachliche Barrieren werden mithilfe von Dolmetschenden oder Übersetzungs-Apps überwunden, bei kulturellen Hürden, etwa wenn der Tod ein absolutes Tabuthema ist, helfen oft Angehörige weiter. Als großes Manko sieht der Palliativarzt und Schmerztherapeut, dass SAPV-Teams leider keine psychologischen Kräfte zustehen.
An ihre Grenzen kommen die Teams auch, wenn organisch schwere Komplikationen drohen, z. B. bei starker Blutungsgefahr. Dann kann eine Einweisung ins Krankenhaus in Abstimmung mit dem Betroffenen und den Beteiligten unumgänglich werden. Ansonsten betreuen die Mitarbeitenden die Schwerstkranken bis zum Tod zu Hause oder im Hospiz. Regelmäßige Supervisionen helfen ihnen, mit den beruflichen Belastungen fertig zu werden.
SAPV: die Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung
Die Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung unterscheidet sich in den einzelnen Regionen und Landesärztekammerbereichen beträchtlich. Neben verschiedenen Vertrags-, Finanzierungs- und Organisationskonstruktionen gibt es unterschiedliche Auffassungen zu den Inhalten und Zielen dieser Leistung: Wann kommt SAPV zum Einsatz, bei welchen Patientengruppen, zu welchem Zeitpunkt. Studienergebnisse zur Bewertung der Leistung werden nicht durchgehend anerkannt.
Einer der Diskussionspunkte sind die Versorgungsstufen Teil- und Vollversorgung. Manche Teams bieten nur eine Teilversorgung an, da nur dann die Hausärztinnen und Hausärzte weiterhin beteiligt bleiben. Andere Teams finden es selbstverständlich, dass auch bei einer Vollversorgung die hausärztlich tätigen Kolleginnen und Kollegen maßgeblich mitarbeiten. Gesetzlich festgelegt ist ohnehin, dass die SAPV ein ergänzendes Angebot darstellt und andere Sozialleistungen davon unberührt bleiben.
Quelle: Schöner Leben ... bis zuletzt 1/25
Quelle: Medical-Tribune-Bericht
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).