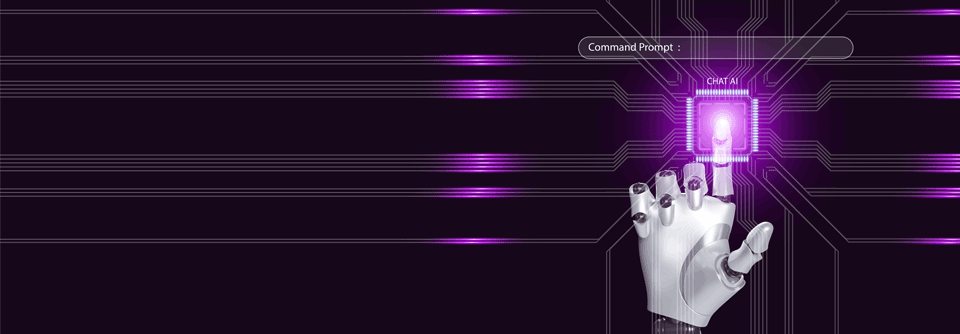
Wie stirbt man heute? Sterben und Trauer im Zeitalter von Avataren
 Es droht der Rückzug aus dem sozialen Leben.
© freeslab - stock.adobe.com
Es droht der Rückzug aus dem sozialen Leben.
© freeslab - stock.adobe.com
Je mehr spezifische Merkmale der Person wiedergegeben werden, um so mehr erliegen die Trauernden der immersiven Illusion, weiterhin mit der verstorbenen Person zu kommunizieren. Doch was als Trost beginnt, führt direkt in die ethische Grauzone – mit Folgen auch für die Begleitung von Sterbenden und Trauernden. Mit der rasanten Entwicklung der KI werden die Nachbildungen immer realistischer erscheinen – in Mimik, Stimme und auch im inhaltlichen Ausdruck.
Wie finden Trauer und Pietät noch ihren Platz?
Die Autorinnen und Autoren der Studie Edilife (Ethik, Recht und Sicherheit des digitalen Weiterlebens) des Fraunhofer SIT und des Internationalen Zentrums für Ethik in den Wissenschaften der Uni Tübingen haben untersucht, was diese Entwicklung für Gesellschaft und Gesundheitswesen bedeutet. Wie finden Trauer und Pietät in diesem soziotechnischen Kontext einen Platz? Wie beeinflusst diese Technik religiöses Leben bzw. Vorstellungen von Transzendenz? Welchen rechtlichen und ethischen Stellenwert haben Handlungen von und an Avataren? Und wie können die Rechte der abgebildeten Personen und ihrer Hinterbliebenen gegenüber den kommerziellen Absichten der Digital-Afterlife-Unternehmen durchgesetzt werden?
Für Menschen in der Medizin oder in der Sterbe- und Trauerbegleitung ist dabei der Aspekt Trauerbewältigung von besonderer Bedeutung. Ein neuerer Ansatz in der Trauerforschung „Continuing Bonds“ plädiert für die Fortsetzung der Beziehung zur verstorbenen Person. Die Einbeziehung eines interaktionsfähigen elektronischen Avatars wäre aus dieser Sicht prinzipiell also denkbar, wird in der Studie diskutiert.
Bedenken gegen eine digital fingierte Gegenwart von Verstorbenen gründen sich u.a. darauf, so die Studie, dass sie die Entfaltung und Verarbeitung von Trauer behindern kann. Die fortwährende Verfügbarkeit der über wenige Klicks erreichbaren medialen Repräsentation wird von den befragten Expertinnen und Experten der Sterbe-, Trauer- und Erinnerungskultur unter dem Aspekt der Distanzlosigkeit kritisiert: Während Friedhofsbesuche oder andere Rituale an analogen Orten von begrenzter Dauer sind und das Verlassen dieser Orte eine Rückkehr in das (wenn auch veränderte) Alltagsleben ermöglicht, könne die digitale Omnipräsenz und Permanenz genau das behindern. Die Kontinuitätsbemühungen nehmen eventuell pathologische Züge an. Zumal zwischen dem von der Digital Afterlife Industry versprochenen Sich-nicht-lösen-Müssen und einem Sich-nicht-lösen-Können ein fließender Übergang sei.
Die Fixierung auf das virtuelle Gegenüber könne einen dauerhaften Rückzug aus dem (nicht digitalen) sozialen Leben bewirken und die Fähigkeit, sich mit den veränderten Lebensumständen zu arrangieren bzw. neue Bindungen mit anderen einzugehen, beinträchtigen und damit zu einer dauerhaften Isolation führen.
Avatare sollten sich nicht selbst einschalten dürfen
Aus den Forschungsergebnissen leiten die Autorinnen und Autoren Handlungsoptionen für den Umgang mit solchen Avataren ab: Sie konzentrieren sich auf digitale Techniken und Praktiken in Bezug auf Tod, Trauern und Erinnern auf privater Erfahrungsebene. Dafür benennen sie kulturelle, rechtliche und sicherheitstechnische Anforderungen wie etwa, dass Plattformen und Dienstanbieter, deren Angebot Avatare des digitalen Weiterlebens beinhalten, klare Richtlinien für die Erstellung und Verwendung sowie Löschung von Avataren Verstorbener festlegen müssen. Personen können dann zu Lebzeiten Anweisungen hinterlassen, wie ihr digitaler Nachlass in Bezug auf einen Avatar behandelt werden soll.
Außerdem sollten Anbieter den Avataren des digitalen Weiterlebens nicht erlauben, selbst den digitalen Nachlass wie E-Mail-Accounts, Konte in sozialen Netzwerken, digitale Vermögenswerte und Telekommunikation der dargestellten Person fortzuführen oder Anwendungen autonom zu starten. Anderenfalls könnten sie die Personen „überraschen, verwirren oder dazu verleiten, den Avatar mit einer lebenden Person zu verwechseln“.
