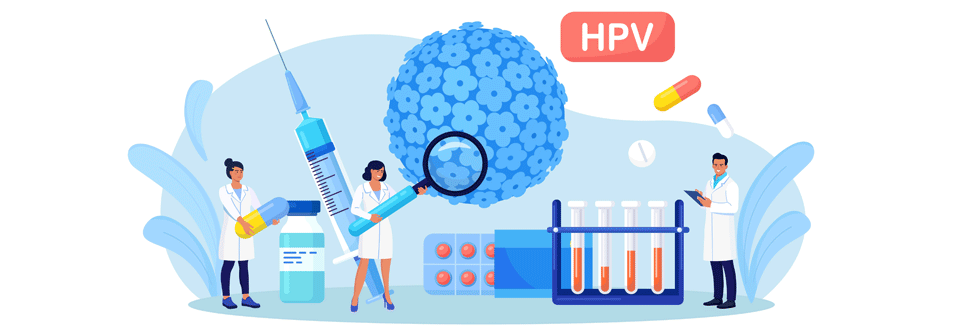Empfehlungen zum Umgang mit Impfzögerern Ein Viertel der Impfskeptiker ist noch ablehnender geworden
 Unsicherheiten im Umgang mit Impfstoffen ist keine Seltenheit. Doch was ist die beste Herangehensweise bei Impfzögerern?
© Halfpoint – stock.adobe.com
Unsicherheiten im Umgang mit Impfstoffen ist keine Seltenheit. Doch was ist die beste Herangehensweise bei Impfzögerern?
© Halfpoint – stock.adobe.com
Die grundlegende Einstellung zum Impfen hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert, wie auch eine aktuelle Befragung der AOK Hessen zeigt. Von den 1.000 Befragten dort hat zwar knapp die Hälfte (46 %) keinen Meinungs-Shift zu diesem Thema bei sich selbst festgestellt. Doch ein Viertel der Befragten ist aktuell positiver eingestellt als zuvor (davon 13 % sogar deutlich positiver), ein anderes Viertel jedoch ist skeptischer geworden (davon 15 % deutlich skeptischer). Frauen sind dabei ein bisschen skeptischer als Männer und je höher der sozioökonomische Status, desto positiver die Einstellung.
Dipl.-Med. Gudrun Widders, STIKO-Mitglied und langjährige Leiterin des Gesundheitsamtes Berlin-Spandau, sieht mehrere Ursachen für diese Skepsis. Zum einen haben seit der Pandemie die sozialen Netzwerke einen immer größeren Impact. Falschinformationen werden dort rasend schnell verbreitet, häufig schneller als die wissenschaftlich fundierte Aufklärung hinterherkommen kann.
Während der Pandemie kamen außerdem Unsicherheiten im Umgang mit neuen Impfstoffen hinzu, welche teils stärkere Reaktionen als gewohnt auslösten – Reaktionen, die von manchen als „Impfschäden“ fehlinterpretiert wurden.
„An dieser Stelle fehlte dann erstmal eine gute Kommunikation und dann die richtigen Ansprechpartner. Denn auch wir haben unsere Erfahrungen erst im Laufe der Pandemie machen können“, sagt Widders.
Heute sind es vor allem die Niedergelassenen, die die Kommunikation mit Zögerern übernehmen müssen. Was sind gute Lösungsansätze zur Impfkommunikation mit Menschen, die Impfungen mit Misstrauen begegnen? Die wichtigsten Ansätze seien gute Informationsmaterialien, empathische Gesprächsführung und Impferinnerung, fasst Widders zusammen. Dabei empfiehlt die ehemalige Amtsärztin vor dem Hintergrund ihrer eigenen Erfahrungen eine empathische Gesprächsführung mit dem Ziel der Erreichung einer eigenen Motivation und zur Widerlegung von Fehlinformationen.
Dabei helfen, eine fundierte Entscheidung zu treffen
„Der wichtigste Satz, den ich Ärztinnen und Ärzten mitgeben möchte, ist: Die Menschen müssen dort abgeholt werden, wo sie sich gerade mit ihren Vorstellungen zum Impfen befinden – egal, ob uns ihre Auffassungen gefallen oder nicht. Wir müssen ihnen helfen, eine wissenschaftlich fundierte Impfentscheidung herbeiführen zu können, indem wir sie mit den entsprechenden Informationen versorgen“, erklärt sie.
Impfskepsis bedeute sicher eine Belastung für die Praxen – aber man habe schließlich die Zielstellung, möglichst hohe Impfraten zu erreichen. Und die Gespräche mit Ärztinnen und Ärzten sind für die meisten Patientinnen und Patienten die vertrauenswürdigsten Informationsquellen.
Infomaterial zum Thema Impfen und Überzeugen
- Lernplattform Jitsuvax zum Umgang mit persönlichen Gesprächen, in denen man mit Fehlinformationen konfrontiert ist: jitsuvax.info/de/welcome/
- Podcastfolge O-Ton Pädiatrie mit Frederike Taubert vom Projekt JITSUVAX: https://www.kinderaerztliche-praxis.de/o-ton-paediatrie#15
- RKI-Ratgeber zu Infektionskrankheiten: www.rki.de/ratgeber
- RKI-Faktenblätter zum Impfen: www.rki.de/impfen-infomaterial
- Fremdsprachige Informationsmaterialien zu Impfungen: www.rki.de/impfen > Informationsmaterialien in verschiedenen Sprachen
- Merkblatt für Ärztinnen und Ärzte mit Hinweisen zum schmerzreduzierten Impfen: www.rki.de/schmerzreduziertes-impfen
- Laien-Informationsmaterialien des Bundesinstitutes für Öffentliche Gesundheit (BIÖG, vorher BZgA) zum Thema Impfen, auch fremdsprachig: www.impfen-info.de/mediathek/printmaterialien
Mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, bedeute in erster Linie einmal zuzuhören. Was sind die Gründe für die Ablehnung? Woher hat die Person ihre Informationen? „Jeder kennt das von sich selbst, wenn man mit Fakten konfrontiert wird, die nicht der eigenen Meinung entsprechen, steht man dem erst mal etwas ablehnend gegenüber. Hier besteht die Herausforderung für das Arzt-Patienten-Gespräch: im Gespräch diese Ablehnung zu verändern“, sagt Widders.
Worauf gründet sich die Skepsis der einzelnen Person?
Wichtige Impulse für die Impfkommunikation liefert das Projekt JITSUVAX unter Leitung von Prof. Dr. Cornelia Betsch der Universität Erfurt. Ziel des Projektes ist es, Ärztinnen und Ärzte zu befähigen, faktenbasiert und empathisch zu kommunizieren – auch bei Gegenwind. Dabei hilft es, die Einstellungswurzeln der Patientinnen und Patienten zu erkennen: Ist das Hauptproblem Unsicherheit, Furcht vor Nebenwirkungen, oder ist es ein grundlegendes Misstrauen gegenüber Institutionen? Kennt man den Ursprung des Widerstandes, kann man gezielt und respektvoll darauf reagieren.
Die Methodik dabei ist, individuelle Einstellungsursachen, die ganz unterschiedlich sein können, wie beispielsweise Sicherheitsbedenken, Misstrauen oder Ängste, zu verstehen, die Fehlannahmen, die dazu beitragen, gezielt und evidenzbasiert zu widerlegen und dann die Patientinnen und Patienten zu einer informierten Entscheidung befähigen. Jede Widerlegung beginnt dabei zunächst mit einer respektvollen Annahme der Bedenken, über die anerkannt wird, wie die andere Person zu den Überzeugungen gekommen ist. Dieser Schritt ermöglicht es, Fehlinformationen in einem persönlichen Gespräch zu widersprechen, ohne die Beziehung zu gefährden.
Quelle: Medical-Tribune-Bericht