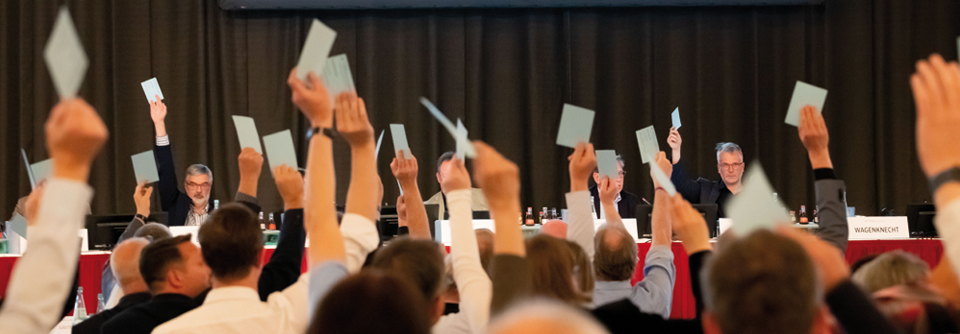Interview Digital Devices im Krankenhaus
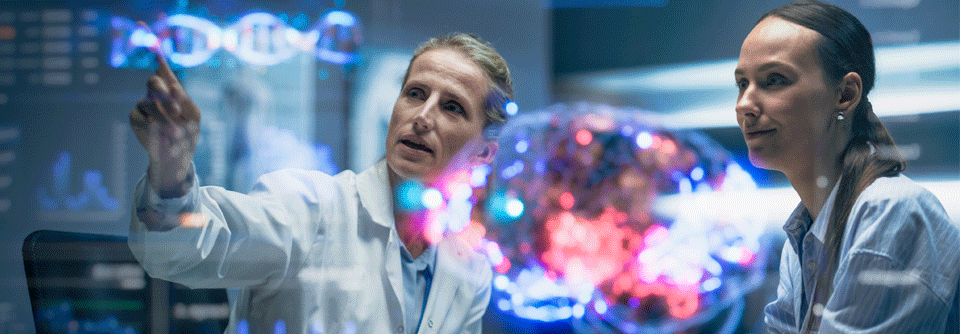 Der Einsatz digitaler Gesundheits- und Pflegetools im stationären Setting unterliegt strengeren Regeln als im privaten Bereich.
© Gorodenkoff - stock.adobe.com
Der Einsatz digitaler Gesundheits- und Pflegetools im stationären Setting unterliegt strengeren Regeln als im privaten Bereich.
© Gorodenkoff - stock.adobe.com
In Deutschland benötigten laut Statistischem Bundesamt im Jahr 2023 mehr als 17 Millionen Menschen einen stationären Aufenthalt. Rund ein Drittel dieser jährlich in ein Krankenhaus eingewiesenen Personen hat die Nebendiagnose Diabetes. Ein Großteil davon sind Patienten mit Typ-2-Diabetes (T2D), die gleichzeitig bereits an Folgeerkrankungen des Diabetes leiden. So wurde in entsprechenden Untersuchungen gezeigt, dass in Deutschland ca. 42 von 100 Menschen mit T2D eine eingeschränkte Nierenfunktion haben. Mit einer Häufigkeit von 20 bis 40% zählt die diabetische Nierenerkrankung damit zu einer der häufigsten dieser Folgeerkrankungen.
Wird für Patienten mit der Nebendiagnose Diabetes, aus welchen Gründen auch immer, eine Krankenhausbehandlung notwendig, „ist das Diabetesmanagement ein bedeutsamer Grundpfeiler für eine angemessene Versorgung“, betonte Prof. Dr. med. Susanne RegerTan, die sich speziell auf die Integration digitaler Tools in die Versorgung von Menschen mit Diabetes fokussiert, in ihrem Statement in der Vorab-Pressekonferenz im Rahmen der 18. Diabetes-Herbsttagung der DDG 2024. Die Direktorin der Klinik für Diabetologie und Endokrinologie, Herz- und Diabeteszentrum NRW führte weiter aus: „Gleichzeitig ist es jedoch für die Therapieteams eine große Herausforderung, denn Glukosekontrolle in akuten Krankheitssituationen ist nicht nur komplexer, sondern ein Diabetes selbst ist auch mit einem erhöhten Morbiditäts- und Mortalitätsrisiko verbunden. … Eine wirkungsvolle Komponente der Diabetesintervention mit großem Zukunftspotenzial zur Verbesserung der Versorgung dieser Patienten stellt die digitale Diabetestechnologie dar.“
Das am weitesten fortgeschrittene digitale Hilfsmittel für Menschen mit Typ-1-, aber inzwischen auch Typ-2-Diabetes, ist die kontinuierliche Glukosemessung (CGM). Die CGM könne zwar den Mangel an Diabetes-Fachkräften in den Krankenhäusern nicht ausgleichen, aber einen Beitrag leisten, auch mit wenigen Fachleuten viele von Diabetes betroffene Menschen in hoher Qualität zu versorgen, ist Reger-Tan überzeugt. Denn die CGM-Technologie – bislang hauptsächlich im ambulanten Bereich nachgewiesen – habe viele Vorteile. So zeige sich der Nutzen von CGM-Systemen in einer multidimensionalen Verbesserung der Glukosestoffwechsellage mit Reduktion des HbA1c, der Glukosevariabilität und Zeit unterhalb des Zieles sowie einer Steigerung der Zeit im Zielbereich. Das Glukosemanagement werde damit leichter, präziser und sicherer. Darüber hinaus kann die CGM auch das kardiovaskuläre Risiko reduzieren, wie erste Studiendaten zeigen. Zudem können Daten in Echtzeit mit behandelnden Kollegen geteilt werden, Insulindosierungen unter Berücksichtigung des Trendpfeils festgelegt und Notfallsituationen mit Hilfe der Alarmfunktion rechtzeitig erkannt werden.
Mit zunehmendem Fortschritt der CGM-Technologie ist inzwischen die Zahl der Menschen mit Diabetes, die mit ihrem eigenen CGM-System ins Krankenhaus kommen oder bei denen das CGM im und durch das Krankenhaus initiiert wird, in der Tat gestiegen, bestätigte Reger-Tan. Aber trotz der aufgezeigten Vorteile, die im Krankenhaussetting besonders wertvoll sein können, gibt es noch immer erhebliche Hürden und rechtliche Bedenken für den Einsatz der CGM im stationären Bereich. „Menschen mit Diabetes, die im häuslichen Umfeld ein CGM nutzen, sind derzeit bei der Einweisung ins Krankenhaus mit der Situation konfrontiert, auf die Standardversorgung mit kapillären 4-Punkt-Glukoseprofilen umstellen zu müssen.“
Die DDG Praxisempfehlung „Digitalisierung in der Diabetologie“ adressiere daher dieses relevante Thema der CGM-Sensorik im Krankenhaus. Ehe es jedoch in der Praxis „funktioniert“, sind einige Voraussetzungen erforderlich.
Nutzung von CGM-Systemen im Krankenhaus – Wo stehen wir heute?
Die Durchführung unabhängiger Studien und Testung von Systemen zur kontinuierlichen Glukosemessung (CGM) liegt, neben der Prüfung weiterer Medizinprodukte für die Diabetestherapie, in der Kernkompetenz des Instituts für DiabetesTechnologie (IfDT), Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH an der Universität Ulm. Der Leiter des IfDT Dr. Guido Freckmann gibt Auskunft zum aktuellen Stand der Nutzung von CGM-Systemen im Krankenhaus.
Was sind die wesentlichen Hindernisse? Welche Hürden konnten bei der Implementierung von CGM-Systemen im Krankenhaus schon genommen werden?
Bisherige CGM-Systeme sind laut Bedienungsanleitung oft nur für die Selbstbehandlung des Diabetes gedacht, gewissermaßen als Ersatz für die Blutzuckerselbstmessung der Patienten. Wird es vom Profi angewendet, kann es kritisch werden, wenn das von der Zweckbestimmung nicht abgedeckt ist. Die Verantwortung für die Richtigkeit der Messwerte geht dann auf die Verantwortlichen im Krankenhaus oder Altersheim über, was sonst dem Hersteller zukommt. Man muss also in die jeweilige Bedienungsanleitung schauen, ob auch die Nutzung durch medizinisches Personal abgedeckt ist. Mittlerweile haben einige Firmen den Passus „nur für die Selbstmessung“ abgeändert; meines Wissens bislang beim Dexcom G7 und beim FreeStyle Libre 3. Damit ist zumindest für diese Geräte schon einmal eine große Hürde genommen worden, und man darf es im stationären Setting einsetzen.
Durch die Zweckbestimmung „nur für die Selbstnutzung“ können rechtliche Probleme entstehen.
Ein Problem, was derzeit noch nicht geregelt ist, betrifft die Qualitätskontrolle. Die herkömmliche Glukosemessung im Krankenhaus und Altenheimen fällt unter die Rili-BÄK (Richtlinien der Bundesärztekammer). Die Rili-BÄK-Qualitätskontrollen sind allerdings nur vorgegeben für Glukosemessungen mit In-Vitro-Diagnostika. Auf CGM-Systeme ist die Rili-BÄK daher nicht anwendbar, weil es sich bei CGM-Systemen um Medizinprodukte handelt. Damit gibt es aber keine etablierte Qualitätskontrolle für diese Messung, im Gegensatz zur Qualitätskontrolle für die In-Vitro-Diagnostik wie beispielsweise für die Blutzuckermessung. Man ist bei der Nutzung gut beraten, wenn man z.B. durch eine Arbeitsanweisung definiert, in welcher Art und Weise man die CGM-Werte nochmals auf ihre Qualität und Richtigkeit kontrolliert, z.B. mit einer bestimmten Anzahl an parallelen kapillären Blutglukose-Messungen. In der Verantwortung steht dann der Betreiber der jeweiligen Einrichtung, Qualitätsvorgaben für den CGM-Einsatz zu implementieren und deren Einhaltung sicherzustellen. Wenn man quasi als Ersatz für qualitätskontrollierte Glukosemessungen die CGM-Werte nimmt, sollte dringend eine adäquate Qualitätssicherung implementiert werden. Die AG Diabetestechnologie und die Kommission Labordiagnostik der Deutschen Diabetes Gesellschaft werden in der nächsten Zeit eine neue Stellungnahme zur Anwendung von CGM in Krankenhaus und Pflege ausarbeiten.
Eine etablierte Qalitätskontrolle für CGM im stationären Kontext gibt es noch nicht.
Ist der Einsatz von CGM-Systemen in allen stationären Bereichen/klinischen Situationen und für alle Patienten, also beispielsweise auf ITS oder für Dialyse- und multimorbide Patienten, geeignet?
Die CGM Funktion kann z.B. durch interferierende Medikamente beeinträchtigt werden. Insbesondere auf der Intensivstation können neben instabilen Kreislaufverhältnissen viele Faktoren wie z.B. Schock, Sepsis, Hypothermie, Niereninsuffizienz oder Flüssigkeitsverschiebungen unter Dialyse die Genauigkeit der CGM-Werte beeinträchtigen. Auf Intensivstation ist der Einsatz von CGM daher derzeit nicht empfohlen. Mittlerweile gibt es auch einige Studien zur Dialyse, die zeigen, dass CGM hilfreich sein kann. Aber auch hier muss man sich informieren, ob das individuelle CGM-Gerät geeignet ist, und sollte dies mit Parallelmessungen überprüfen. Ich denke, für Altenheime und Normalstationen reicht sicherlich eine weniger häufige Kontrolle. Klare Vorgaben für eine Qualitätskontrolle gibt es aber noch nicht.
Welche Hauptaufgaben stehen aktuell in Bezug auf den zukünftigen Einsatz von CGM-Systemen im stationären Bereich an? Wer ist dafür zuständig?
Die Hauptverantwortung liegt bei den Gesundheits-Einrichtungen und den Herstellern. Anwender im stationären Bereich müssen wissen, welche Randbedingungen beim Einsatz von CGM-Systemen zu beachten sind, welche Qualitätskontrollen müssen wie oft durchgeführt werden und wie man das organisatorisch regeln kann.
Wir als IfDT sind daran beteiligt, Standardisierung für CGM-Systeme zu erarbeiten, quasi wie für Blutzucker-Messgeräte auch für CGM-Systeme. Wir haben Prozeduren erarbeitet, um die Messqualität und die Messgenauigkeit von CGM zu standardisieren. Derzeit gibt es noch keine gute Vergleichbarkeit von Studien, die von Anbieter-Firmen mit unterschiedlicher Methodik durchgeführt wurden. Unser Ziel ist, eine einheitliche Prozedur zu entwickeln und zu veröffentlichen. Wir erhoffen uns zudem, mehr Transparenz bei den Zulassungsverfahren für neue Systeme und damit verbunden eine erhöhte Sicherheit für die Anwender von CGM-Systemen zu schaffen. Das ist allerdings ein langwieriges und mühsames Vorhaben. Parallel dazu ist aber auch die Entwicklung klinikspezifischer Standards notwendig.
Mit welchen Zeiträumen ist zu rechnen?
Der Plan ist, noch in diesem Jahr ein Konsensuspapier der Arbeitsgruppe zu kontinuierlichem Glukosemonitoring der Internationalen Gesellschaft für Klinische Chemie und Labormedizin (IFCC WG-CGM), die bereits seit 2019 daran arbeitet, zu publizieren (s. a. www.ifdt-ulm.de/ueber-uns/eigene-forschung). Das beginnt jetzt gerade auch wahrgenommen zu werden, so dass die Firmen mittlerweile aufmerksam geworden sind. Wir wollen das nun weiter voran treiben und hoffen, dass zeitnah die Erstellung eines ISO-Standards begonnen werden kann. Vielen Dank, Herr Dr. Freckmann, für dieses Gespräch.
Quelle: Nierenarzt/Nierenärztin ?/2025