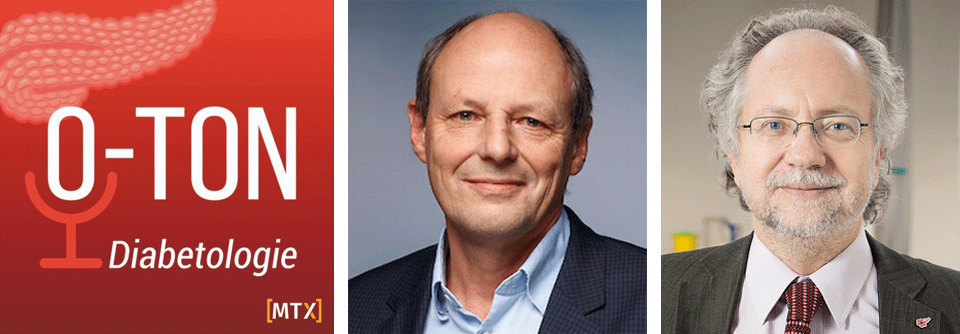CGM: Mehr Therapiesicherheit für Ältere Expertentalk: Neue Diabetes-Technologien und gesundheitspolitische Ignoranz
 Ein großer Teil der Personen mit Diabetes unter 19 Jahren nutzen bereits CGM, aber auch immer mehr über 60-Jährige.
© Halfpoint – stock.adobe.com
Ein großer Teil der Personen mit Diabetes unter 19 Jahren nutzen bereits CGM, aber auch immer mehr über 60-Jährige.
© Halfpoint – stock.adobe.com
Mit einem massiven Anstieg der CGM- und AID-Systeme auf knapp 3 Mio. Nutzende ist laut aktuellem dt-report in den nächsten fünf Jahren zu rechnen, so PD Dr. Dominic Ehrmann vom Forschungsinstitut der Diabetes-Akademie Bad Mergentheim (FIDAM). Diese Systeme zählten zu den Hilfsmitteln und verursachten mit 4 % nur einen geringen Anteil der Gesamtkosten im Gesundheitswesen, vor allem im Vergleich zu den deutlich höheren Ausgaben für Krankenhausaufenthalte, ambulante Behandlung und Medikamente, betonte Prof. Dr. Bernhard Kulzer, ebenfalls vom FIDAM. Insgesamt liegen die Kosten für alle Hilfsmittel des Diabetes (z. B. CGM, AID-Systeme, Blutzuckermessung, Pens, Spritzen) bei jährlich rund 2 Milliarden Euro, was angesichts der jährlichen Ausgaben für Diabetes von etwa 38,5 Milliarden Euro nur circa 5 % der Kosten ausmache.
Gesundheitsökonomische Studien zeigten überdies, dass Diabetes-Technologien, die aufgrund glykämischer Effekte kurzfristig höhere Kosten verursachten, mittel- und langfristig effizient seien. Diese Bilanz verbessere sich noch, wenn man deren Ausgaben reduziere, was langfristig zu erwarten sei. Konkret führte Prof. Kulzer eine veränderte Verordnungspraxis an, wie einen intermittierenden Gebrauch von CGM beim Typ-2-Diabetes sowie einfachere, kostengünstigere Systeme. Neue Chancen böten erweiterte technische Optionen, etwa bei der personalisierten Mustererkennung oder beim Nutzerfeedback mithilfe Künstlicher Intelligenz.
Ob im stationären oder ambulanten Bereich: Bei aktuellen Reformgesetzen wie KHVVG, KHAG oder GVSG spiele die Diabetologie „keine Rolle“, werde „einfach vergessen“, so Dr. Christian Graf, Bereichskoordinator Versorgung bei der Barmer. Allenfalls ließe sich der Schaden in diesem Bereich „mit viel Mühe“ abwenden. Dabei könnte die Diabetologie längst „Vorreiter für eine integrierte, digitale und qualitätsorientierte Versorgung in Deutschland sein“, betonte Dr. Graf.
Doch die Chancen durch sektorenübergreifende Ansätze würden nicht konsequent genutzt. Bestes Beispiel: das digitale DMP, das aktuell stagniere. Zwar hat der G-BA die Grundlagen für ein dDMP bei Typ-1- und Typ-2-Diabetes im März beschlossen, bevor es jedoch in die Versorgung kommen kann, muss das BMG erst die technischen Anforderungen per Rechtsverordnung regeln. Mit der Einführung der dDMP ist deshalb frühestens ab 2026 zu rechnen.
Dr. Graf stellte eine aktuelle Analyse von Krankenkassendaten zur Nutzung von Diabetes-Technologien sowie zur Digitalisierung vor. Seit 2014 seien zwar die Ausgaben für Blutzuckerteststreifen um 62 % gesunken, gleichzeitig kam es aber zu einer Kostensteigerung für die Glukosemessung von 61 % innerhalb von zehn Jahren. Auf die GKV hochgerechnet mache dies etwa 630 Mio. Euro an Mehrkosten im Jahr 2024 aus, was etwa dem Gesamtvolumen der GKV für die Primärprävention entspreche. Die Ursache sieht er vor allem in einem Preiseffekt. Betrachte man die Entwicklung der rtCGM nach Zielgruppen, lasse sich erkennen, dass es GKV-weit einen Anstieg der Fallzahlen in den letzten drei Jahren um 22 % gab, berichtete Dr. Graf.
Anteil der über 60-Jährigen, die CGM nutzen, wächst
Der größte relative Anstieg um 36 % ist in der Altersgruppe der über 60-Jährigen feststellbar: 360.000 Menschen mit Diabetes – das sind 51 % aller rtCGM-Nutzerinnen und -nutzer – haben ein solches System. Und 97 % der insulinpflichtigen Personen mit Typ-1- oder Typ-2-Diabetes unter ICT-Therapie im Alter bis 19 Jahre nutzen es, das sind circa 41.000 Menschen mit Diabetes. Bei den über 60-Jährigen tragen bislang 56 % aller ICT-Nutzenden ein rtCGM-System. Bei Insulinpumpen und AID-Systemen hätten sich seit 2020 zudem die GKV-weiten Zahlen auf 70.000 Fälle in 2024 verdreifacht. Überdies seien 30 % der Pflegebedürftigen an Diabetes erkrankt, auf die GKV hochgerechnet kommt man auf 1,6 Mio. Personen. In der Altersgruppe ab 70 Jahren liege der Anteil an Menschen mit Diabetes mit Insulin, ICT und rtCGM bei Pflegebedürftigen noch höher.
Als weitere Handlungsfelder der Diabetes-Technologie sieht der Kassenvertreter vor allem deren intermittierenden Einsatz beim Typ-2-Diabetes: als Biofeedback z. B. im Rahmen von Schulungen bzw. DiGA (seit 2024 zugelassen sind „Una Health“ und „glucura“ mit CGM-Sensoren), aber auch zur Prozessverbesserung im Krankenhaus bei der Nebendiagnose Diabetes. Denn obwohl diese häufigster Anlass für einen stationären Aufenthalt von Menschen mit Diabetes sei, „werde sie nicht mitbehandelt bzw. noch nicht einmal kodiert!“, kritisierte er. Denkbar wäre hier ein Monitoring und die Mitbehandlung im Rahmen von Telekonsilen durch Diabeteszentren. Besonderen Bedarf sieht der Experte im Schulungsbereich.
Obwohl Patientenschulungen eigentlich integraler Bestandteil der DMP Diabetes seien, zeige der DMP-Qualitätsbericht der KV Nordrhein von 2023, dass im DMP Typ-2-Diabetes nur 34,6 % der Eingeschriebenen jemals geschult worden seien, nur 43,7 % wurde überhaupt eine Schulung angeboten, kritisierte Dr. Graf. In anderen KV-Bereichen seien die Zahlen noch niedriger. Abhilfe könnten überregionale Online-Angebotsplattformen von Diabetespraxen und -kliniken schaffen.
Hoher Zeitaufwand für Schulung, Beratung und Therapieanpassung, zusätzliche Kosten für Technik, Software und Weiterbildung des Teams, keine Investitionsanreize für Praxen: Die Versorgungsrealität zeigt, dass die ambulante Diabetologie zunehmend unter wirtschaftlichem Druck steht. Der Mehraufwand bleibt unvergütet – der Beruf verliert an Attraktivität. Denn auch die aktuelle Finanzierung über das DMP spiegelt den Aufwand nicht wider.
Über die Finanzierung von Leistungserbringung sprach die Hausärztin und Diabetologin Dr. Antje Weichard, Vorstandsmitglied des BVND, die hier dringenden Handlungsbedarf sieht. Forderungen hierzu wurden bereits von DDG, BVND und bndb formuliert (www.ddg.info/presse/2025). Die Vergütungssysteme müssten den Aufwand realistisch abbilden, zudem seien Förderprogramme für Technik und Weiterbildung der Praxen erforderlich. „Und es braucht die politische Anerkennung der ambulanten Diabetologie als tragende Säule der Gesundheitsversorgung“, betonte sie.
Die Nutzung von Diabetes-Technologie im höheren Alter wertet Dr. Ann-Kathrin Meyer, Chefärztin der Geriatrie an der Asklepios Klinik Wandsbek, als „Meilenstein“ für die Therapiesicherheit – sowohl im Selbstmanagement als auch, wenn Pflegekräfte und/oder Angehörige diese Aufgabe übernähmen.
Ältere nutzen Technologie ähnlich gut wie Jüngere
Dass auch ältere Menschen mit Diabetes sehr gut mit Diabetestechnologien zurechtkommen und ähnliche Ergebnisse erzielen wie jüngere Personen, zeigte Prof. Dr. Norbert Hermanns vom FIDAM anhand der Auswertungen des dt-reports. Dr. Maria-Lena Weiss, Beauftragte der Unionsfraktion für Medizinprodukte im Gesundheitsausschuss und Mutter einer Tochter mit Typ-1-Diabetes, schätzt die Chancen durch Daten und Digitalisierung in der Diabetesversorgung als „gewaltig“ ein. „Jede vermiedene Komplikation und jedes gewonnene Lebensjahr sind der Beweis, dass Digitalisierung wirkt“, so die Juristin.
Quelle: Medical-Tribune-Bericht