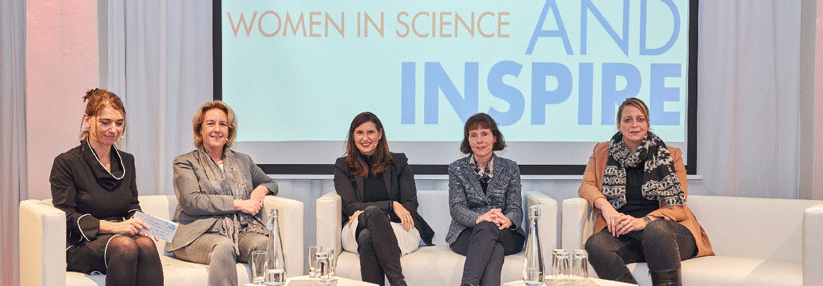
Gleiches Geld für Frauen – Jobmodelle mit Familie – mehr Karriere-Chancen
„Schwester, kommt der Doktor heute auch noch zu mir?“ – Nie werde ich die Frage der betagten Patientin vergessen, die sie mir bei meiner ersten Visite damals als frisch gebackene junge Ärztin stellte. Kein Wunder: Denn nach ihrer Vorstellung war der Arzt gewohnheitsmäßig ein Mann.
Inzwischen hat sich das Bild aber gründlich gewandelt: Fast die Hälfte der medizinischen Versorgung in Deutschland wird heute durch Frauen geleistet. Die Überzahl der Männer ist geschwunden, doch offenbar nicht die Übermacht.
„Frau Doktor“ ist üblich, „Frau Professor“ selten Die Anrede „Frau Doktor“ kommt den Patienten längst geläufig über die Lippen. Geht es hingegen um die „Frau Professor“ sinnbildlich für Ärztinnen in Führungspositionen, klingt das ungewohnt. Wiederum kein Wunder: Während über 60 % der Weiterbildungsstellen im Krankenhaus von Ärztinnen eingenommen werden, wird zur Spitze der Karriereleiter die Luft für Frauen rasch dünner. Nur rund 26 % der Leitungsfunktionen in deutschen Krankenhäusern werden nach einer Statistik der Unternehmensberatung Kienbaum von Frauen besetzt.

„Interessanterweise sind die Chancen der Frauen auf Führungspositionen damit aber größer als in Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft“, räumt Diplom-Ökonom Thomas Thurm in „XX – Die Zeitschrift für Frauen in der Medizin“ ein (1). Dort stellen Frauen in der obersten Führungsebene nur 6 %, auf den Ebenen darunter liegt die Quote bei 10 bzw. 14 %.
Gender-Pay-Gap auch im Krankenhaus
Die männliche „Übermacht“ schlägt sich nicht allein auf die Positionssaussichten, sondern auch auf die Einkommens-Chancen nieder. Nach Thurms Analyse beschert das neudeutsche „gender pay gap“ Klinikärztinnen im Vergleich zu männlichen Kollegen je nach Funktionslevel fachübergreifend ein Minus zwischen 1,5 % und 9 % auf der Gehaltsabrechnung – Ausnahmen sind die Pädiatrie und Psychiatrie, wo Frauen geringfügig mehr als Männer verdienen.
Was sind im „Zeitalter der Gleichstellung“ Gründe für die ungleiche Bezahlung von Frauen und Männern? Dass das Phänomen einer diskriminierenden Personalstrategie entspringt, ist laut Thurm nicht anzunehmen. Da fehlender Nachwuchs im Arztberuf ein zunehmendes Problem ist und Frauen derweil mehr als die Hälfte der Studienabgänger in der Humanmedizin ausmachen, stehen Klinikbetreiber unter Zugzwang, besonders für Ärztinnen attraktive Arbeitsbedingungen zu bieten.
Traditionelle Rollenbilder sind immer noch in den Köpfen
Thurm weist daraufhin, dass es hier mit der Vergütung nicht getan ist. „Das Wirtschaftssystem ist heute noch überwiegend darauf ausgelegt, Eigenschaften wie Machtstreben, Durchsetzungskraft und körperliche Belastbarkeit zu belohnen – alles Eigenschaften, die traditionell vor allem Männern zugeschrieben werden. Es spricht aber vieles dafür, dass die Arbeitsbedingungen der Zukunft eher Eigenschaften wie Partnerschaftlichkeit, Empathie und Kommunikationsstärke erfordern.“
Familienkompatible Arbeitsbedingungen und Karrierechancen
Will heißen: Für Frauen wie für Männer sind familienkompatible Arbeitsbedingungen und Karrierechancen gefragt, die beider Geschlechter Lebensentwürfe mit dem Beruf in Einklang bringen. Angebote zur Kinderbetreuung, flexible Arbeitszeitmodelle und Leistungen zur Alters- und Gesundheitsvorsorge müssen attraktive Arbeitgeber für Ärztinnen heute vorhalten.
Bei allen Karriere-Ideen wünschen sich Ärztinnen heute vor allem, dass Zeit für ein Privatleben bleibt, um etwa Familienpläne zu verwirklichen oder Hobbys zu pflegen. Männliche Kollegen gehören dabei zwecks stimmiger Work-Life-Balance miteinbezogen.
Dies war – stellvertretend für alle ärztlichen Disziplinen – auch der Tenor der Podiumsdiskussion beim „Forum Frauen in der Dermatologie“ (2).
Die Förderung von Frauen in der Medizin kann nur Früchte tragen, wenn sie in allgemeine Anstrengungen zur Förderung angehender Ärztinnen und Ärzte verankert ist. Neue Erhebungen belegen, dass die meisten Medizinerinnen vor allem in den alten Bundesländern bei Aufnahme ihrer Berufstätigkeit noch sehr traditionelle Rollenvorstellungen haben und mit Blick auf die Zeit nach der fachärztlichen Weiterbildung weit seltener eine leitende Position anstreben als Männer (3).
Diese wichtigen Erkenntnisse über die Lebensentwürfe von Studienabgängerinnen ändern aber nichts daran, dass die karrierefreudigen Frauen auf der Leiter zur Chefarztposition eklatant benachteiligt sind. „Den großen Knick gibt es nach der Promotion“, erklärte Professor Dr. Martina Müller-Schilling, Direktorin der Klinik und Poliklinik für Innere Medizin 1, Universitätsklinikum Regensburg.
Vor allem in dieser Phase müsse die Nachwuchsförderung bei Frauen intensiv ansetzen: Liegt unter den Doktoranden der Frauenanteil noch bei gut 40 %, sind Ärztinnen bei der Habilitation gerade mal noch mit 20 % im Rennen. Heißt „mehr Ärztinnen“ auch „mehr Chefinnen“? Mit welchen Maßnahmen soll man diesem „gender gap“ bei Führungspositionen begegnen? Wird sich die dortige Unterrepräsentation von Ärztinnen mit der steigenden Zahl an Ärztinnen von allein regulieren? Oder sind Quoten-Chefinnen in der Medizin eine Lösung?
Professor Dr. Claudia Traidl-Hoffmann, Oberärztin an der Universitätsklinik und Poliklinik für Dermatologie und Allergologie am Biederstein, München, wehrt sich gegen die Idee einer quantitativ betriebenen Spezialförderung für Ärztinnen. „Wir müssen durch Kompetenz überzeugen. Ich will keine Quotenfrau sein und leiste deshalb 100 % in der Klinik und 100 % in der Wissenschaft.“
Vielmehr müssen Frauen dazu motiviert werden, Führungsaufgaben zu übernehmen, erklärte Professor Dr. Dorothée Nashan, Direktorin der Hautklinik des Klinikums Dortmund. Nach ihrer Erfahrung trauen sich Frauen aber oft nicht zu, Führungsaufgaben zu übernehmen. Spezielle Mentorenprogramme könnten helfen, diese Hemmschwellen zu überwinden.
Wie in der Diskussionsrunde immer wieder deutlich wurde, legen junge Medizinerinnen heute vor allem darauf Wert: Sie wollen Erfolg und Freude im Beruf erleben – dies aber nicht mit dem Verzicht auf ein erfülltes Privatleben erkaufen.
1. T. Thurm, XX – Die Zeitschrift für Frauen in der Medizin, 2012, Heft 1: 26-31, Georg Thieme Verlag
2. „Forum Frauen in der Dermatologie“, Veranstalter: Abbott Immunology, 27.-28. April 2012, Düsseldorf
3. B. Gedrose et al., „Haben Frauen am Ende des Medizinstudiums andere Vorstellung über Berufstätigkeit und Arbeitszeit als ihre männlichen Kollegen?“, Dtsch Med Wochenschr 2012; 137: 1242-1247
4. Dr. med. Astrid Bühren, Dr. oec. Anke Tschörtner, „Ich bin Ärztin“ – Studie zur Arbeitssituation und Zufriedenheit von Frauen in der Medizin, 2011, Georg Thieme Verlag
