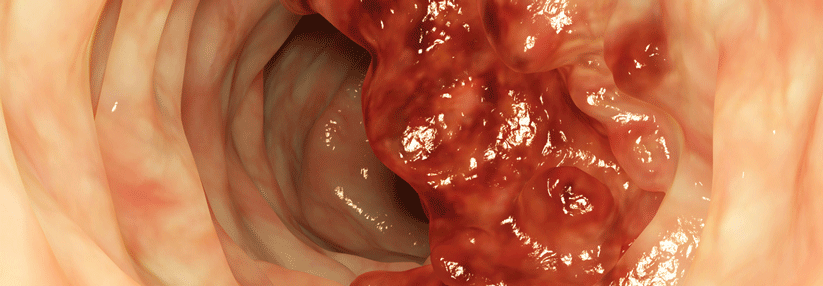Hilferuf nach mehr Psychoonkologie
 Jeder dritte Krebspatient nutzt eine Beratungsstelle – 15 Monate nach der Diagnose.
© iStock/Ridofranz
Jeder dritte Krebspatient nutzt eine Beratungsstelle – 15 Monate nach der Diagnose.
© iStock/Ridofranz
Die Krebsberatungsstellen sollten deutlich gestärkt werden. Das war die zentrale Botschaft der Arbeitsgemeinschaft für Psychoonkologie in der Deutschen Krebsgesellschaft bei ihrer Jahrestagung in Berlin. „Es gibt eine erhebliche Diskrepanz zwischen auftretenden psychischen Belastungen und der Inanspruchnahme von Leistungen“, beklagte der Medizinpsychologe Dr. Uwe Koch-Gromus, Dekan der Medizinischen Fakultät der Uni Hamburg.
Die Psychoonkologen setzen große Hoffnungen in die vom Bundesgesundheitsministerium (BMG) dieses Jahr eingesetzte Arbeitsgruppe „Qualitätssicherung und Finanzierungsmodelle für Krebsberatungsstellen“ im Rahmen des Nationalen Krebsplans. Dipl.-Psych. Martin Wickert von der Bundesarbeitsgemeinschaft für ambulante psychosoziale Krebsberatung sagte, dass die finanzielle Situation vieler Beratungsstellen „prekär bis existenzbedrohend“ sei, nicht wenige stünden „kurz vor der Schließung“.
Hoffnung auf eine baldige finanzielle Lösung
Dabei seien die Einrichtungen für einen signifikanten Anteil der Patienten inzwischen unverzichtbarer Bestandteil der Therapie, wie Dr. Jochen Ernst darlegte. Dr. Ernst ist Mitarbeiter der Abteilung für Medizinische Psychologie der Universität Leipzig. Aktuell ist der Soziologe an einer Evaluation aller knapp 160 von der Deutschen Krebshilfe unterstützten Krebsberatungsstellen beteiligt.
Die bisher unveröffentlichte Studie zeige, dass jeder dritte Krebspatient Beratungsstellen nutze, sagte Dr. Ernst. Die Patienten seien im Schnitt 54 Jahre alt, „also relativ jung“, meist weiblich, und kämen durchschnittlich 15 Monate nach der Krebsdiagnose zur Beratung. Am wichtigsten sei ihnen dabei, das habe eine Befragung im Rahmen der Evaluation gezeigt, Hilfe bei seelischen Belastungen. Das Problem ist, so Dr. Ernst: „Es gibt oft zu wenig Psychologen in den Beratungsstellen.“
Der Berater Wickert hofft, dass man mit der Arbeitsgruppe im BMG „2018 einer Regelfinanzierung sehr nahe ist oder sie schon hat“. Dafür bräuchte es aber einen gemeinsamen Kraftakt aller Beratungsstellen. „Eine Finanzierung wird es nur auf Grundlage einheitlicher Qualitätsstandards geben“, sagte Wickert. Mit einheitlichen Standards meint er unter anderem Vorgaben, welche Qualifikationen Mitarbeiter haben müssten und welche Beratungen angeboten werden sollten.
Eine Ausweitung auf medizinische Beratungen könne er sich vorstellen. „Diese Diskussion muss man führen“, sagte er. Er denke dabei weniger an fachärztliche Beratung als an die Vermittlung von „medizinischen Basisinformationen“. Krebsberatungsstellen beraten derzeit vorrangig zu psychosozialen Themen.
Dass es künftig für Psychoonkologen auch darum gehen wird, bei Patienten Vorbehalte gegen ihre Angebote abzubauen, machte am Tag zwei der Konferenz Dr. Peter Herschbach deutlich. Der Direktor des Krebszentrums des Münchner Universitätsklinikums zitierte eine Untersuchung an seiner Klinik, laut der nur jeder zweite Krebspatient, bei dem eine psychische Belastung als Folge seiner Erkrankung festgestellt worden sei, eine Therapie habe in Anspruch nehmen wollen.
Angst vor Stigmatisierung, Scham, zu wenig Information
Gründe, aus denen betroffene Patienten eine Behandlung ablehnten, gebe es viele, sagte Dr. Herschbach: die allgemeine körperliche Verfassung, Scham, Angst vor Stigmatisierung, eine negative Einstellung gegenüber Psychotherapie, mangelnde Information über Psychoonkologie, hinreichende Unterstützung durch die Familie, Verleugnung. Der Ball läge vor allem bei den Psychoonkologen, ihr eigenes Angebot den Patienten nahezubringen und Ängste zu nehmen, sagte Dr. Herschbach. „Da müssen wir wirklich besser werden.“
Quelle: 16. Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft für Psychoonkologie in der Deutschen Krebsgesellschaft