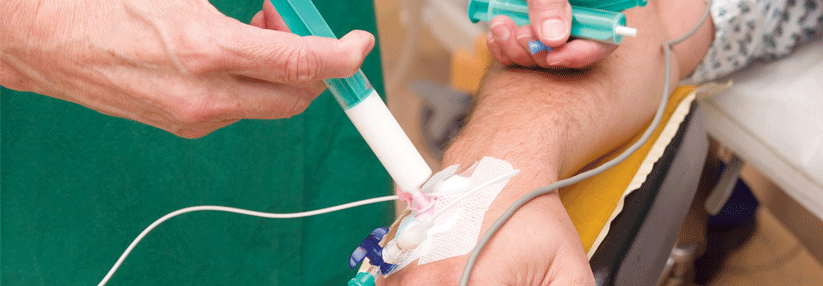Beweislastumkehr und Härtefallfonds Leichterer Behandlungsfehler-Nachweis gefordert
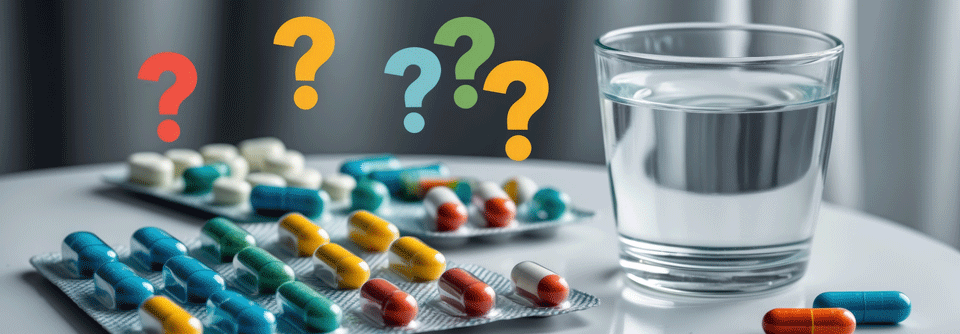 Schadensersatz für eine falsche Medikation oder eine fehlerhafte Behandlung einzufordern, ist für Patientinnen und Patienten in Deutschland enorm schwierig.
© AkuAku - stock.adobe.com (Generiert mit KI)
Schadensersatz für eine falsche Medikation oder eine fehlerhafte Behandlung einzufordern, ist für Patientinnen und Patienten in Deutschland enorm schwierig.
© AkuAku - stock.adobe.com (Generiert mit KI)
Im Jahr 2024 ist die Zahl der vermuteten Behandlungsfehler, die den elf AOKen gemeldet wurden, leicht gestiegen. 16.660 Meldungen gingen demnach ein. In rund 29 % der abschließend bearbeiteten Fälle wurde tatsächlich ein Fehler festgestellt (n = 5.335). Die meisten Meldungen entfielen auf orthopädische oder unfallchirurgische Eingriffe, gefolgt von Behandlungen in den Fachgebieten Chirurgie, Frauenheilkunde und Geburtsmedizin, Innere Medizin sowie Zahnmedizin.
Derzeit ist es für Patientinnen und Patienten sehr schwer, Behandlungsfehler nachzuweisen und eine Entschädigung geltend zu machen. Sie müssen dafür beweisen, dass ein medizinischer Fehler vorlag und dieser mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ursächlich für den entstandenen Schaden ist. Der AOK-Bundesverband und die Verbraucherzentralen fordern daher Erleichterungen für Betroffene. Statt des bisherigen Vollbeweises soll laut AOK eine überwiegende Wahrscheinlichkeit von mehr als 50 % genügen.
In anderen EU-Ländern springen Fonds finanziell ein
Die Stiftung Patientenschutz sprach sich anlässlich des Tages der Patientensicherheit am 17. September gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sogar für eine vollständige Beweislastumkehr und für einen Härtefallfonds aus. Ein solcher könnte greifen, wenn Behandlungsfehler durch Gutachten von Krankenkassen oder Ärztekammern bestätigt wurden, aber Leistungserbringer nicht zahlen. Die Stiftung fordert eine gesetzliche Regelung. In anderen EU-Ländern gibt es ähnliche Fonds, die einspringen, wenn ein Schaden nicht zweifelsfrei ärztlich verschuldet oder einfach schicksalshaft war.
Noch schwerer als der Nachweis von Behandlungsfehlern ist der von Arzneimittelschäden. Betroffene müssen den Beweis führen, dass kein anderer Umstand für den eingetretenen Schaden ursächlich war. Das sei „praktisch unmöglich“, heißt es in einem Positionspapier der AOK, denn die Entstehung von Gesundheitsschäden sei stets individuell und multifaktoriell bedingt. Patientinnen und Patienten in Deutschland müssten daher überhaupt in die Lage versetzt werden, Schadensersatzansprüche durchsetzen zu können. Zusätzlich soll laut der Krankenkasse das Einsichtsrecht in die elektronische Patientenakte rechtlich präzisiert und erweitert werden – mit Einblick in die Metadaten und die Änderungshistorie.
Derweil steigt die Skepsis von Eltern gegenüber Klinikaufenthalten von Kindern. Laut einer forsa-Umfrage im Auftrag der KKH Kaufmännischen Krankenkasse äußert ein Viertel der befragten Eltern von Kindern bis zwölf Jahre diesbezüglich Sorgen. Vor vier Jahren waren es noch 19 %.
Angst vor Krankenhauskeimen und Komplikationen bei OP
Rund drei Viertel aller Befragten würde den Ärztinnen und Ärzten im Krankenhaus aktuell jedoch vertrauen. „In erster Linie sorgen sich Eltern vor der Infektion ihres Nachwuchses mit einem Krankenhauskeim. Aber auch die Notwendigkeit einer erneuten Operation bzw. Komplikationen bei der Narkose sind für jeweils knapp zwei Drittel der besorgten Eltern Vorkommnisse, die Angst machen“, erklärt Vijitha Sanjivkumar vom Kompetenzteam Medizin der KKH. Mangelhafte Medizinprodukte oder die Möglichkeit, dass OP-Besteck im Körper vergessen werden könnte, seien dagegen nur für jeweils rund ein Drittel ein Grund zur Beunruhigung.
Quelle: Medical-Tribune-Bericht