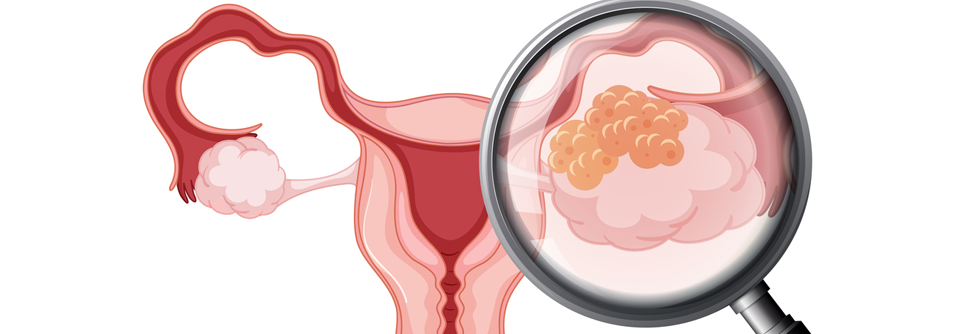
Ovarialkarzinom Ovarialkarzinom: Medizinische Labore drängen auf mehr genetische Diagnostik
 ALM e.V. fordert stärkere Einbindung in die Versorgung bei genetischer Testung von Eierstockkrebs.
© Phimwilai – stock.adobe.com
ALM e.V. fordert stärkere Einbindung in die Versorgung bei genetischer Testung von Eierstockkrebs.
© Phimwilai – stock.adobe.com
Die Labordiagnostik ist in der Versorgung von Patientinnen mit Eierstockkrebs ein unverzichtbarer Bestandteil – sei es bei der Tumormarkerbestimmung, der Risikoabschätzung oder bei genetischen Analysen“, betonte anlässlich des Welt-Eierstockkrebs-Tag
Dr. Michael Müller, 1. Vorsitzender des ALM e.V. Tumormarker wie CA-125 und HE4 oder der ROMA-Score unterstützten die klinische Entscheidungsfindung, molekulare Diagnostik liefere personalisierte Therapieoptionen – „und all das zuverlässig, schnell und qualitätsgesichert in den fachärztlichen Laboren vor Ort“.
Im Bereich der genetischen Diagnostik, etwa bei BRCA1- und BRCA2-Mutationen, zeigt sich laut Müller der Nutzen labormedizinischer Expertise deutlich. Genetische Beratungen und Testungen dürfen bislang allerdings nur im Rahmen der besonderen Versorgung gemäß § 140a SGB V und von wenigen universitären Zentren für familiären Brust- und Eierstockkrebs (FBREK) durchgeführt werden.
Jan Kramer, stellvertretender Vorsitzender des ALM e.V., zeigt für die aktuelle Lage kein Verständnis, denn die Folge seien lange Wartezeiten, Versorgungslücken und hoher logistischer Aufwand – insbesondere für Patientinnen außerhalb der Ballungsräume. Laut Kramer ließe sich das ändern, denn „unsere humangenetischen Labore verfügen über fachliche Qualifikation, moderne Technik, zertifizierte Qualitätssicherung und den direkten Zugang zu Patientinnen“.
Kostenübernahme
Zur Betreuung von Ratsuchenden mit einer familiären Belastung für Brust- und/oder Eierstockkrebs hat das Deutsche Konsortium mit vielen gesetzlichen Krankenkassen nach §140a SGBV sowie mit dem Verband der privaten Krankenversicherer (PKV) einen Vertrag zur Kostenübernahme der molekulargenetischen Testung, abgeschlossen. Diese Verträge beinhalten eine pauschalisierte Vergütung der von uns durchgeführten Leistungen, sofern die im Vertrag festgelegten Einschlusskriterien erfüllt sind.
Sollte dies bei der Krankenkasse der/des Versicherten nicht der Fall sein, unterstützen die Zentren des Konsortiums Sie gerne vorab bei einem Kostenübernahmeantrag der Krankenkasse bzw. können je nach Zentrum bereits Erkrankten die Kosten im Rahmen einer ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung (ASV) gemäß § 116b SGB V oder erkrankten sowie gesunden Ratsuchenden über Medizinische Versorgungszentren (MVZ) gemäß § 95 SGB V in Rechnung gestellt werden.
Quelle:
konsortium-familiaerer-brustkrebs.de
Nachsorge bei Eierstockkrebs
Der ALM verweist zugleich auf die zentrale Rolle in der Nachsorge und bei der Therapieüberwachung von Eierstockkrebs. Regelmäßige Verlaufskontrollen ermöglichten ein frühzeitiges Erkennen von Rückfällen – oft noch vor dem Auftreten klinischer Symptome. Es sei deshalb höchste Zeit, dass diese Kompetenz strukturell anerkannt und in bestehende Versorgungsverträge eingebunden werde.
Bereits im März 2022 hatte der ALM in einem Positionspapier moniert, die zentralisierte Versorgung über universitäre Zentren kritisiert. Dies stehe dem Prinzip einer wohnortnahen und dezentralen Patientenversorgung entgegen. Betont wurde, dass sich die entsprechenden Laborkapazitäten zwecks Versorgungssicherheit nur über eine strukturelle Öffnung der Versorgungsverträge und systematische Einbeziehung ambulanter fachärztliche Leistungserbringer effizient nutzen ließen.
Laut ALM gibt es derzeit 20 FBREK-Zentren, die das „Deutsche Konsortium Familiärer Brust- und Eierstockkrebs“ bilden. Diese zertifizierten Einrichtungen müssten bestimmte Eignungsanforderungen erfüllen, was aber praktisch nur von Universitätskliniken zu leisten ist. Es könnten bisher auch nur jene Patientinnen und Patienten dieses Versorgungskonzept in Anspruch nehmen, deren gesetzliche oder private Krankenkasse über den speziellen Vertrag zur besonderen Versorgung nach § 140 a SGB V die Vergütung sicherstelle.


