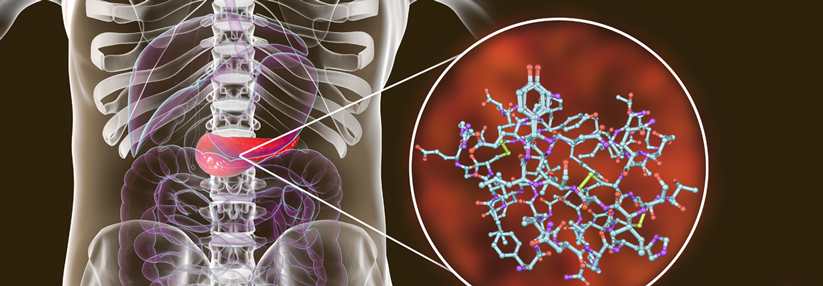
Diskussion Typ-1-Diabetes früher diagnostizieren und behandeln – aber wie?
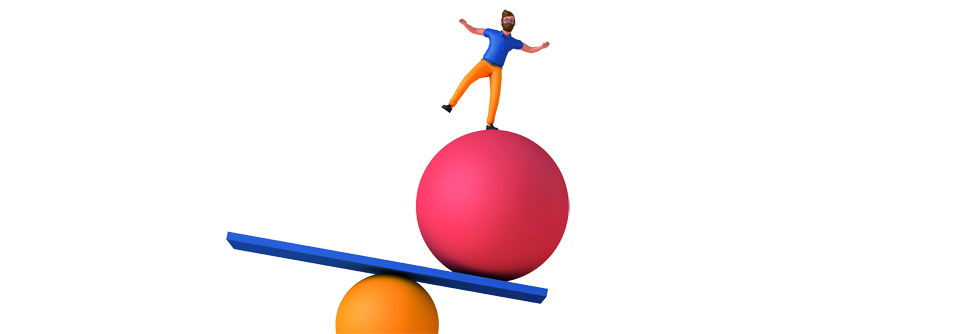 Welcher Standpunkt ist der richtige, wenn es um die Früherkennung geht? Fachleute sind auf der Suche nach Balance.
© ink drop – stock.adobe.com
Welcher Standpunkt ist der richtige, wenn es um die Früherkennung geht? Fachleute sind auf der Suche nach Balance.
© ink drop – stock.adobe.com
Seit 2015 wurden in Bayern im Rahmen des Fr1da-Programms über 173.000 Kinder zwischen zwei und sechs Jahren auf Inselautoantikörper untersucht. Dabei wurden bis dato 504 Kinder identifiziert, bei denen zwei oder mehr der entscheidenden Inselautoantikörper vorliegen, die als Biomarker für eine frühe Diagnose des Typ-1-Diabetes gelten. „Wir konnten in früheren Studien zeigen, dass die Spezifität dieser Antikörper sehr hoch ist“, berichtete Professor Dr. Anette-Gabriele Ziegler vom Institut für Diabetesforschung am Helmholtz-Zentrum München, „nahezu 100 Prozent dieser Kinder entwickeln im Laufe ihres Lebens einen klinisch manifesten Typ-1-Diabetes“.
Ketoazidose-Risiko reduzieren und die Manifestation verzögern
Bislang konnte man diesen Kindern und ihren Familien kein echtes therapeutisches Angebot machen, um den weiteren Verlauf zu beeinflussen. Schließlich kann beim Typ-1-Diabetes nach wie vor lediglich das fehlende Insulin substituiert werden, ohne Option auf eine kausale Therapie. Immerhin wurden die Betroffenen ausgiebig geschult und psychologisch begleitet, um auf die letztlich unausweichliche Manifestation besser vorbereitet zu sein. Bereits hierin liegt für Befürworter*innen des Screenings wie Prof. Ziegler ein klarer Vorteil: „Die Teilnahme an dem Screening reduziert das Risiko einer diabetischen Ketoazidose“, betonte sie mit Blick auf Daten aus dem DPV-Register. Auch die Betazellfunktion zum Zeitpunkt der klinischen Diagnose sei bei Fr1da-Kindern besser als bei Kindern ohne vorheriges Screening. Und abgesehen vom initialen Schock unmittelbar nach dem positiven Screening-Ergebnis berichten die Eltern von gescreenten Kindern auch über eine bessere Lebensqualität und geringere psychische Belastung als diejenigen, bei deren Kindern die Diagnose Typ-1-Diabetes quasi aus heiterem Himmel über sie hereinbrach.

Doch in naher Zukunft dürfte mit Teplizumab, das in den USA bereits zugelassen ist, auch in Europa eine medikamentöse Immuntherapie zur Verfügung stehen, mit der sich die klinische Manifestation eines Typ-1-Diabetes um durchschnittlich drei Jahre verzögern lässt. „Dieses Potenzial sollte niemandem vorenthalten werden“, meinte Prof. Ziegler, „doch Voraussetzung für den Einsatz von Teplizumab ist ein vorangegangener Autoantikörpertest.“ Schließlich sollte das Medikament im Frühstadium des Typ-1-Diabetes eingesetzt werden, wenn noch keine klinischen Symptome zu beobachten sind. Weil 95 % aller Menschen mit Typ-1-Dia-betes keinen Blutsverwandten mit derselben Erkrankung haben, ist es aus ihrer Sicht sinnvoll, ein Screening nicht nur bei genetischer Vorbelastung anzubieten, sondern als freiwillige Leistung in die Regelversorgung aufzunehmen.
Abwägung zwischen Nutzen und Risiko: nicht eindeutig?
Für Prof. Dr. Dr. Beate Karges von der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Aachen fiel die Abwägung zwischen Nutzen und Risiko hingegen anders aus. Sie wies darauf hin, dass die WHO ein Populations-Screening u.a. nur dann für angezeigt hält, wenn ein wichtiges Gesundheitsproblem in der präklinischen Phase heilbar oder die Prognose bei früher Diagnose und Behandlung erheblich besser ist. „Der Antikörpertest auf Typ-1-Diabetes erkennt zwar ein – künftiges – Risiko, nicht aber eine manifeste Erkrankung“, erklärte sie, „zudem ist der Erkrankungsbeginn individuell nicht prognostizierbar.“ Selbst mit einer Immuntherapie sei keine Prävention, sondern nur eine Verzögerung der Manifestation möglich – allerdings um den Preis etlicher potenzieller Nebenwirkungen. Zudem sei die glykämische Kontrolle bei frühem Behandlungsbeginn lediglich in den ersten Jahren, aber nicht dauerhaft besser.
Man könne auch mit gezielter Aufklärung über typische Diabetessymptome die Ketoazidoserate effektiv verringern. Im Durchschnitt komme es in 20 % der Fälle bei der Manifestation zu einer Ketoazidose. „Doch bei der Manifestation bei einem zweiten Familienmitglieds liegt die Kedoazidoserate nur bei 7 %, weil die Familie bereits mit den Alarmzeichen vertraut ist“, argumentierte Prof. Dr. Karges. Zudem könne man mithilfe moderner Diabetestechnologie die Therapie auf Populationsebene verbessern: „Typ-1-Diabetes ist mittlerweile gut behandelbar.“
In der Diskussion prallten die Positionen aufeinander
Für ebendiese Äußerung erntete Prof. Karges in der anschließenden Diskussion heftige Kritik vom Kinderdiabetologen Prof. Dr. Thomas Danne vom Kinderkrankenhaus auf der Bult in Hannover: „Es macht mich wütend, wenn Diabetes bei Kindern als eine heutzutage gut behandelbare Erkrankung dargestellt wird. Sie ist immer noch eine enorme Belastung für die Familien.“ Außerdem zeigten die Daten des schwedischen Diabetesregisters, dass Jungen mit Typ-1-Diabetes 14 Lebensjahre und Mädchen sogar 17 Jahre verlieren. „Drei Jahre Verzögerung können da viel ausmachen.“
Prof. Dr. Giovanni Maio, Medizinethiker von der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg wiederum gab zu bedenken, dass ein positives Screening-Ergebnis „die Vorwegnahme einer Erkrankung und der damit verbundenen Sorge“ bedeute. Wenn ein Kind z.B. die Pubertät noch ohne Diabetes überstehen könne, sei das zwar hilfreich. „Doch auch wenn ich die neuen medikamentösen Möglichkeiten sehr begrüßenswert finde, müssen wir die schwerwiegenden Folgen des Tests im Blick behalten, weil wir eben keine wirkliche Therapie anbieten können.“ Er sieht die behandelnden Ärzt*innen in der Beratung- und Gesprächspflicht, aber nicht in der Testpflicht: „Der Umgang mit den neuen Möglichkeiten muss besonnen und nicht automatisiert erfolgen.“
Auch die Berliner Kinderendokrinologin Dr. Kathrin Griffig, die sich aus dem Plenum zu Wort meldete, zeigte sich skeptisch: „Meine Angst wäre, dass es im Falle eines regelhaften Screening-Angebots eben keine routinehaften Beratungs- und Aufklärungsgespräche gäbe.“ Sie habe Fälle erlebt, in denen Familien infolge eines Autoantikörpertests „im Nichts gelandet sind“ und das Wissen um die künftige Erkrankung dem Kind nicht gut getan hat. Für Professor Dr. Andreas Neu, mittlerweile DDG Past Präsident, war damit klar: „Wir haben wahrgenommen, wie wichtig und aktuell, aber auch kontrovers dieses Thema ist. Es ist wichtig, diese Kontroversen in der Fachgesellschaft offen auszutragen.“
Diabetes Kongress 2023






