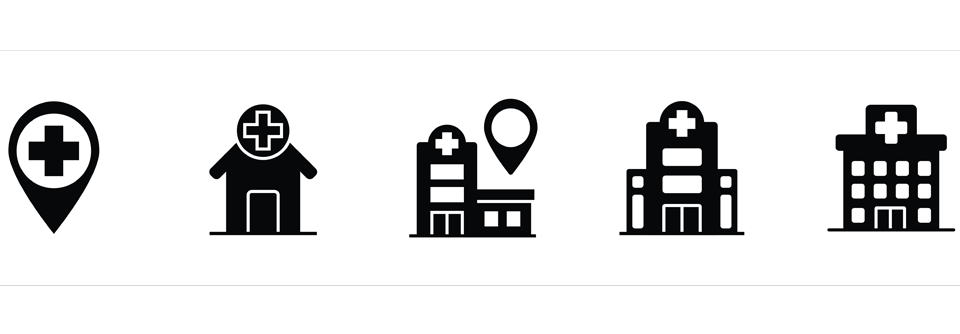Klinikreform erfordert Kooperationen Umgestaltung des stationären Sektors ist nicht nur eine Frage des Geldes
 Was den politischen versprochenen Bürokratieabbau angeht, wird dieser „ohne eine flächendeckende Digitalisierung kaum möglich“ sein, ist Prof. Müller-Wieland überzeugt.
© deagreez - stock.adobe.com
Was den politischen versprochenen Bürokratieabbau angeht, wird dieser „ohne eine flächendeckende Digitalisierung kaum möglich“ sein, ist Prof. Müller-Wieland überzeugt.
© deagreez - stock.adobe.com
Vier von fünf Kliniken schreiben laut der Deutschen Krankenhausgesellschaft rote Zahlen. Die Bundesgesundheitsministerin stellt ab Herbst „Soforthilfen“ in Aussicht. Die Rede ist von vier Mrd. Euro, verteilt auf zwei Jahre. Mit dem Gesetzentwurf zur Anpassung der Krankenhausreform könnte sich das Bundeskabinett im September befassen. Die Bundesländer sollen z. B. mehr Spielraum bekommen, zu entscheiden, welche Häuser auf dem Land fortbestehen sollten.
Notwendig sei eine nachvollziehbare und transparente Trennung der Zuständigkeiten, erklärt Prof. Dr. Dirk Müller-Wieland, Co-Vorsitzender der Kommission Struktur der Krankenversorgung bei der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM). Das heißt: Finanzierung durch den Bund, aber Strukturgestaltung im Konsens mit den Ländern. Schließlich fällt die Krankenhausplanung in ihre Hoheit.
Es müssten Prioritäten gesetzt und müsste strategisch entschieden werden, sagt der Facharzt für Endokrinologie und Diabetologie am Universitätsklinikum Aachen. Das solle aber nicht „von oben kommen“, sondern bevölkerungsorientiert sein. Krankenhäuser müssten zudem bereit sein, zu kooperieren. „Ja, wir brauchen Geld, aber nur welches für sinnvolle, effizientere Strukturen und für eine Versorgungsgestaltung zugunsten der Patienten.“
Der Arzt erwartet, dass sich die Bundesregierung „sehr ernsthaft“ mit dem Personalbemessungstool der Bundesärztekammer auseinandersetzen wird. Zu berücksichtigen sei dabei auch die Aufgabe der Weiterbildung im stationären Bereich.
Nachbesserungsbedarf bei den Leistungsgruppen
Speziell in der Angiologie bangt die DGIM um die künftige Versorgung. Werde dieser internistische Schwerpunkt nicht mit einer eigenen Leistungsgruppe in der Planung berücksichtigt, bestehe die Gefahr, dass er für den akademischen Nachwuchs unattraktiv werden könnte. Handlungsbedarf zur Sicherstellung der Versorgung gebe es ferner z. B. in der Infektiologie und bei Querschnittsfächern wie der Diabetologie oder der Altersmedizin. Diese müssten gut und differenziert in den Leistungsgruppen abgebildet werden. „Wir machen uns große Hoffnung, dass das im Rahmen einer Verbesserung des Gesetzes berücksichtigt wird.“
Was den politischen versprochenen Bürokratieabbau angeht, wird dieser „ohne eine flächendeckende Digitalisierung kaum möglich“ sein, ist Prof. Müller-Wieland überzeugt.
Verteilung von Aufgaben ist zu überdenken
Das bedeute aber nicht, bürokratische Prozesse zu elektrifizieren. Vielmehr müssten diese verschlankt und Genehmigungswege abgeschafft werden. Notwendig sei ein Umdenken beim Delegieren und der Übernahme von Verantwortlichkeiten.
Was können Klinikmanagement sowie Ärztinnen und Ärzte heute schon tun, um sich und ihre Abteilungen auf die Krankenhausreform vorzubereiten? Prof. Müller-Wieland hat darauf eine strategische Antwort mit Blick auf Kooperationsnetzwerke und die Entwicklungen in der Medizin sowie einen taktischen Hinweis: „Der Leistungsgruppen-Grouper kann nur erkennen, was kodiert wird.“ Sie wollen mehr dazu wissen? Dann hören Sie rein beim O-Ton Innere Medizin.
Mehr zum O-Ton Innere Medizin
O-Ton Innere Medizin ist der Podcast für Internist:innen. So vielfältig wie das Fach sind auch die Inhalte. Die Episoden erscheinen alle 14 Tage donnerstags auf den gängigen Podcast-Plattformen.