
Fehldiagnosen in der ePA Wie man rechtssicher falsche Einträge in der digitalen Akte korrigiert
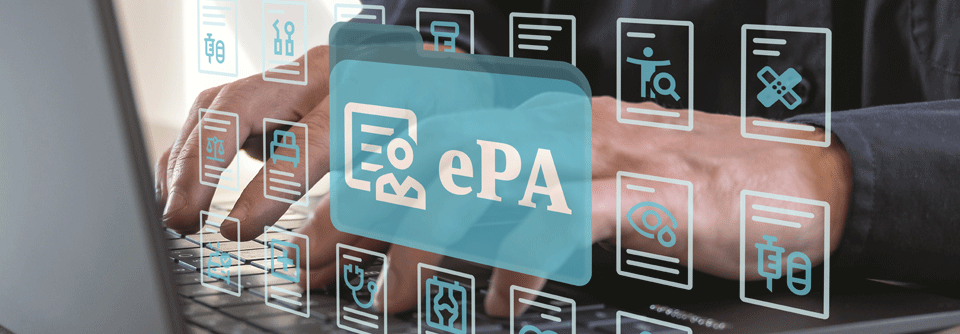 Sie sollte durch Transparenz das Vertrauen in die medizinische Dokumentation stärken. Nun deckt sie systematisch Fehldiagnosen auf: die ePA.
© sh99 - stock.adobe.com
Sie sollte durch Transparenz das Vertrauen in die medizinische Dokumentation stärken. Nun deckt sie systematisch Fehldiagnosen auf: die ePA.
© sh99 - stock.adobe.com
Sie sollte durch Transparenz das Vertrauen in die medizinische Dokumentation stärken. Nun deckt sie systematisch Fehldiagnosen auf: die ePA. Durch die Einsichtnahme in die Akte erfahren manche Patientinnen und Patienten erstmals von bis dato unbekannten oder falschen Diagnosen. Die können aber richtige Probleme machen, etwa beim Abschluss einer privaten Kranken-, Lebens- oder Berufsunfähigkeitsversicherung. Will eine Patientin oder ein Patient eine Diagnose korrigiert haben, gilt die behandelnde Ärztin oder der Arzt als erste Adresse.
Der Bundesärztekammer (BÄK) liegen nach eigenen Angaben keine Informationen darüber vor, ob und wie häufig es zu falschen Dokumentationen oder zu gehäuften Beschwerden kommt. Auch nicht im Kontext mit der ePA.
Bei der Bewertung von Fehldiagnosen in der ePA müsse man zunächst die beiden Ebenen der Patientendokumentation unterscheiden, so die Kammer: Herzstück für die detaillierte Dokumentation über Symptome, die durchgeführte Diagnostik und vereinbarte Therapie durch die Ärztin oder den Arzt ist das Praxisverwaltungssystem (PVS), in dem die gesamte Behandlung im Detail aufgezeichnet wird. Die wichtigsten Informationen aus dem PVS wie relevante Diagnosen und wesentliche Befunde finden sich dann später in weiteren Dokumenten, wie im Arztbrief.
Anderen Regeln folgt dagegen die Dokumentation zum Zweck der Abrechnung gegenüber den KVen beziehungsweise den gesetzlichen Kassen. Die ICD-10-Codes erlauben oft aber keine detaillierte patientenindividuelle Darstellung. „Daher kann es zu einer Diskrepanz zwischen der Diagnose, die in der Behandlung festgehalten und im Praxisverwaltungssystem des Arztes dokumentiert wurde und der codierten Diagnose kommen“, so die Bundesärztekammer. Die ePA wiederum enthält eine stark komprimierte Version der Behandlungsdaten.
Vorsicht beim Löschen ursprünglicher Einträge
Wie handelt man in der ärztlichen Praxis aber nun rechtlich sicher, wenn eine Patientin oder ein Patient mit ePA-Ausdrucken in die Sprechstunde kommt und Erklärungen zu einer Diagnose fordert, etwa zur Frage: „Warum steht hier etwas von depressiver Episode? Ich war damals nur wegen Schlafproblemen bei Ihnen.“ In solchen Fällen sind die „Hinweise und Empfehlungen zur ärztlichen Schweigepflicht, Datenschutz und Datenverarbeitung in der Arztpraxis“, die von der BÄK und der KBV gemeinsam herausgegeben werden (siehe vor allem die Seiten A-12 und A-19) hilfreich. So müssen Berichtigungen und Änderungen von Eintragungen in der Behandlungsdokumentation nachvollziehbar sein, sind demnach nur zulässig, wenn neben dem ursprünglichen Inhalt erkennbar bleibt, wann sie vorgenommen wurden (§ 630f Abs. 1 BGB), so die BÄK. Die Korrekturen müssen zudem transparent sein, ursprüngliche Einträge dürfen nicht einfach gelöscht oder überschrieben und auch der Grund der Änderung muss vermerkt werden. Ärztinnen und Ärzten ist daher angeraten, „die rechtlichen Vorgaben für die Dokumentation zu beachten“, empfiehlt die Ärztekammer.
Eine wichtige Entlastung bedeutet der Paragraph 350 Abs. 4 SGBV. Korrigiert eine Ärztin oder ein Arzt demnach eine Fehldiagnose und begründet dies fachlich, sind die Krankenkassen dazu verpflichtet, auch die bereits übermittelten Abrechnungsdaten zu dem Vorgang zu berichtigen. Die korrigierten Angaben werden dann automatisch an den ePA-Anbieter weitergeleitet und in der Patientenakte aktualisiert.
Quelle: Medical-Tribune-Bericht


