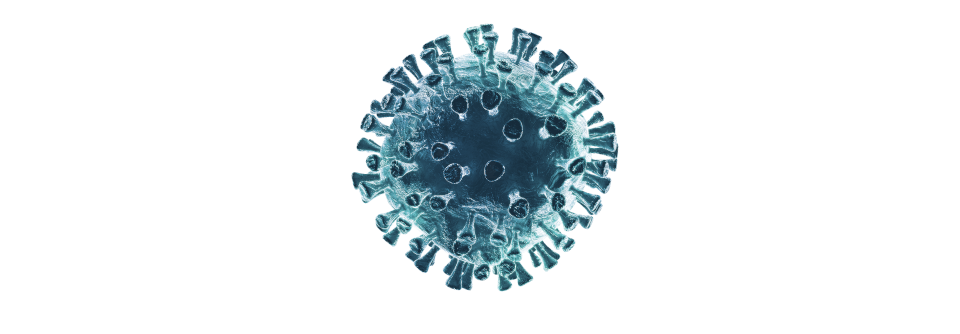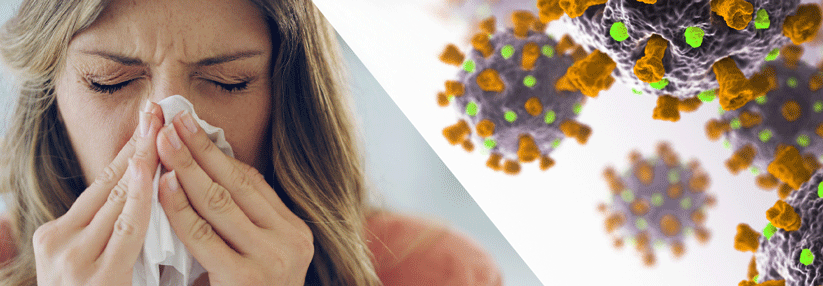Glukokortikoide bei Lupusnephritis optimal anpassen
 Dosierung und Form der Glukokortikoid-Therapie bei aktiver Lupusnephritis werden in der Praxis unterschiedlich gehandhabt.
© volha_r - stock.adobe.com
Dosierung und Form der Glukokortikoid-Therapie bei aktiver Lupusnephritis werden in der Praxis unterschiedlich gehandhabt.
© volha_r - stock.adobe.com
Bei einer aktiven Lupusnephritis empfehlen sowohl der ACR als auch die EULAR die initiale Kombinationstherapie. Als Partner für die notwendigen Glukokortikoide (GC) stehen Mycophenolat-Mofetil (MMF), Cyclophosphamid, Belimumab, Calcineurininhibitoren und inzwischen auch Obinutuzumab zur Auswahl, berichtete Dr. Johanna Mucke, Rheumazentrum Ruhrgebiet, Herne. Die Dosierungen für die Begleiter der GC sind jeweils gut definiert. Doch wie hoch und in welcher Form sollten die Glukokortikoide bei der akuten Lupusnephritis eingesetzt werden? Das wird in der Praxis oft unterschiedlich gehandhabt, sagte die Expertin. US-amerikanische Forschende haben deshalb versucht, mithilfe einer Metaanalyse den Einfluss von Glukokortikoidregimen auf den renalen Therapieerfolg sowie die Infektions- und Sterblichkeitsrate bei Betroffenen mit Lupusnephritis zu bewerten. Herangezogen wurden dafür 37 Studien mit 50 RCT-Armen und über 3.000 Patientinnen und Patienten.
Steroidpulse steigerten Remissions- und Sterberate
Bei der Analyse stellte sich ein klarer dosisabhängiger Zusammenhang zwischen GC-Dosis und allen drei Outcomes heraus: Eine höhere Glukokortikoidexposition während der Initialbehandlung der Lupusnephritis ging mit besseren renalen Remissionsraten einher, allerdings auf Kosten einer erhöhten Rate schwerer Infektionen und einer leicht erhöhten Mortalität. Die zusätzliche Gabe von GC-Pulsen steigerte die Remissionsrate deutlich, im längeren Verlauf allerdings auch die Sterberate, nicht aber das Risiko für schwere Infektionen.
Das beste Nutzen-Risiko-Profil errechneten die Forschenden für die Dosierung von 40 mg/d plus GC-Pulsen, berichtete Dr. Mucke. Das bedeutet nun nicht, dass alle Patientinnen und Patienten dieses Regime bekommen müssen – die GC-Therapie sollte weiterhin individuell nach Risikoprofil der Betroffenen gestaltet werden, betonte die Referentin. Die Daten zeigen ihr zufolge aber deutlich, dass die Pulstherapie das Outcome durchaus verbessert.
Egal welcher Einsatz: Langfristig sollten Glukokortikoide auf 5 mg/d getapert und am besten ganz abgesetzt werden – da sind sich Expertinnen und Experten einig. Ob das Absetzen auch beim Lupus möglich ist, prüfte ein chinesisches Team bei 333 Betroffenen mit lang anhaltender klinischer Remission, die unter Hydroxychloroquin (HCQ) und niedrig dosiertem Kortison standen und keine weitere immunsuppressive Therapie erhielten. Die Studie lief über 33 Wochen und hatte drei Arme (HCQ und GC abgesetzt, nur GC abgesetzt, HCQ und GC weiter eingenommen). Erwartungsgemäß kam es in der medikamentenfreien Gruppe am häufigsten zu Schüben (26,1 %), gefolgt von dem HCQ-Arm, in dem nur die GC abgesetzt worden waren (11,2 %). Die Gruppe, in der die Patientinnen und Patienten HCQ und GC weitergenommen hatten, wies eine Schubrate von 4,7 % auf. Die Non-Inferiority zwischen der medikamentenfreien Gruppe und der Gruppe mit Erhaltungstherapie (HCQ plus GC) konnte nicht bestätigt werden. Anders sah dies im Vergleich der beiden Behandlungsgruppen aus. Hier wurde die Non-Inferiority erreicht.
Das Absetzen von Glukokortikoiden scheint bei SLE-Patientinnen und -Patienten mit lang anhaltender klinischer Remission möglich zu sein, schlussfolgert Dr. Mucke. HCQ verhindert jedoch offenbar Schübe und sollte deshalb unbedingt beibehalten werden.
Quelle: Deutscher Rheumatologie Kongress 2025
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).