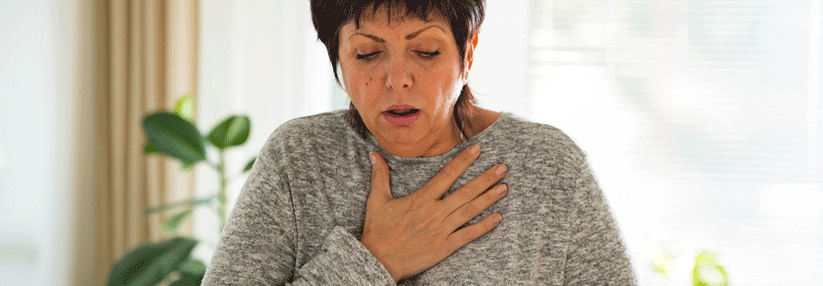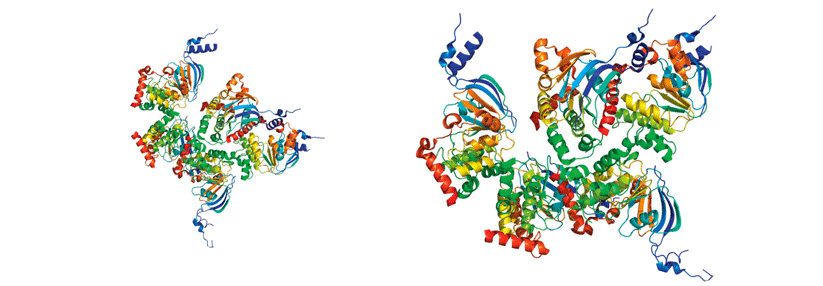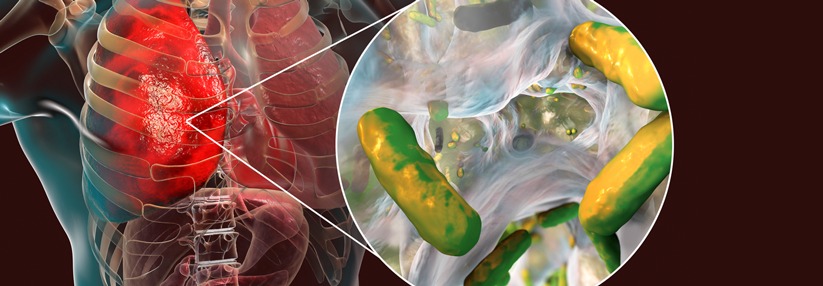Jeder Dritte mit aquagener Keratodermie hat einen Defekt im Mukoviszidose-Gen
 Nach Wasserkontakt zeigen sich bei einer Patientin weiße, ödematöse Papeln und Plaques.
© Fotolia/SENTELLO
Nach Wasserkontakt zeigen sich bei einer Patientin weiße, ödematöse Papeln und Plaques.
© Fotolia/SENTELLO
Schon seit vier Jahren hat die junge Frau die Beschwerden mit den „wasserbedingten“ Hautveränderungen. Diese verursachen weder Brennen noch Schmerzen oder Juckreiz, allenfalls eine leichte Druckdolenz. Nach dem Händetrocknen bilden sich die Plaques innerhalb weniger Stunden weitgehend zurück, aber nie vollständig.
Therapie mit Aluminiumchlorid und Wasser-Iontophorese
Nach diagnostischer „Wasserprovokation“ entwickeln sich an der feuchten Hand innerhalb von Minuten disseminierte ödematöse Papeln, die teilweise zu größeren Plaques konfluieren. Die trockene Hand bleibt ebenso wie das übrige Integument erscheinungsfrei. Histologisch ergibt sich eine leichte Verhornungsstörung ohne entzündliche Komponente. Anhaltspunkte für Atopie oder Hyperhidrose fehlen, die Therapie mit Aluminiumchlorid führt zu keiner Besserung.
Die konsultierte Assistenzärztin Gülcin Mengi von der Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie des Universitätsklinikums Frankfurt am Main, bestätigt der Patientin eine aquagene palmoplantare Keratodermie. Der Kontakt mit Wasser oder Schweiß löst die Hauterkrankung aus und führt häufig zu Brennen, Schmerzen oder Juckreiz. Typisch ist die fast vollständige Rückbildung der Symptome an Händen und Füßen innerhalb weniger Minuten bis Stunden nach dem Trocknen. Die Keratodermie beginnt meist in der Adoleszenz, betrifft vor allem Frauen und kann selten auch einseitig auftreten.
Schmerzmittel und Sulfasalazin unter Verdacht
Pathogenetisch wird z.B. eine vermehrte Flüssigkeitsabsorption über die palmoplantare Hautbarriere diskutiert – ausgelöst durch eine erhöhte Chloridkonzentration im Schweiß. In Studien hatte etwa ein Drittel der Patienten mit aquagener Keratodermie eine Mutation in dem von der Mukoviszidose bekannten CFTR-Gen (Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator). Deshalb empfiehlt die Autorin eine Messung des Schweißchloridgehalts, ggf. ergänzt durch einen CFTR-Genstatus. Als weitere Auslöser der aquagenen Keratodermie kommen Medikamente wie ASS, Indometacin, Sulfasalazin und COX-2-Inhibitoren infrage – ohne dass der pathogenetische Zusammenhang geklärt wäre.
Die Autorin rät zur topischen Anwendung von Aluminiumchlorid-Lösung oder Leitungswasser-Iontophorese über mehrere Wochen. Auch Injektionen mit Botulinumtoxin sollen hilfreich sein. Das Toxin hemmt die Schweißdrüsen-Aktivität und reduziert dadurch die Chloridsekretion.
Quelle.: Weberschock T, Kleimann P, Wolter M, Kaufmann R. „Frankfurter Dermatologentagung - 2. November 2016“ Akt Dermatol 2016; 42: 467-482, DOI 10.1055/s-0042-117407 © Georg Thieme Verlag, Stuttgart
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).