
Psychische und kognitive Symptome bei Long COVID
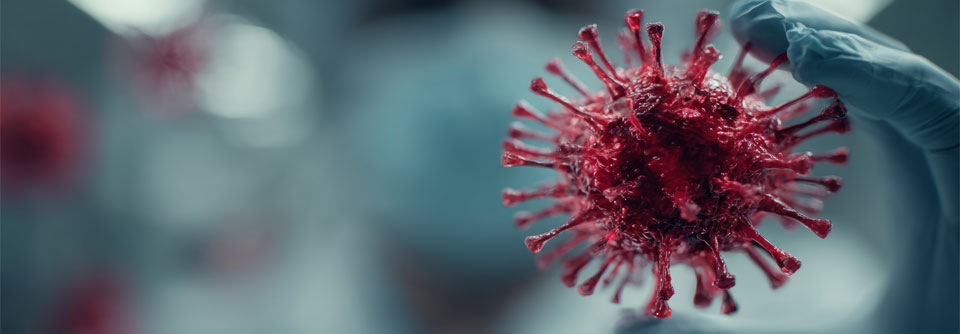 86 % der arbeitenden Teilnehmer von Post-COVID-Gruppen berichten, dass kognitive Dysfunktion ihre berufliche Leistung verringerte.
© SHI – stock.adobe.com
86 % der arbeitenden Teilnehmer von Post-COVID-Gruppen berichten, dass kognitive Dysfunktion ihre berufliche Leistung verringerte.
© SHI – stock.adobe.com
Etwa einer von fünf Erwachsenen mit Long COVID entwickelt anhaltende neuropsychiatrische Symptome. Besonders gefährdet sind Frauen und ältere Menschen nach schwerer Infektion. Ein Überblick zum aktuellen Kenntnisstand.
Typisch für die mentale Beteiligung bei COVID-19 sind Konzentrations- und Gedächtnisdefizite sowie Depressivität und übersteigerte Ängstlichkeit, die nach der Akuterkrankung mindestens 12 Wochen persistieren, also häufig länger als andere Long-COVID-Symptome. Wenn vorhanden, sind die objektiven kognitiven Defizite meist mäßig ausgeprägt. Longitudinalen Daten zufolge können die psychiatrischen Beschwerden auch erst Wochen bis Monate nach der akuten Erkrankung auftreten, schreibt eine Forschergruppe um Prof. Dr. Eleni Aretouli von der Universität Ioannina.
Laut Schätzungen weisen global 6 % der symptomatischen COVID-19-Überlebenden drei Monate nach der akuten Erkrankung mindestens eines der drei folgenden Symptom-Cluster auf:
- persistierende Erschöpfung mit Schmerzen oder Stimmungsschwankungen
- kognitive Defizite
- Atemwegsprobleme
86 % der arbeitenden Teilnehmer von Post-COVID-Gruppen berichten, dass kognitive Dysfunktion ihre berufliche Leistung verringerte. Einer Metaanalyse zufolge musste die Hälfte derjenigen, die drei Monate nach der Infektion erfolgreich an ihren Arbeitsplatz zurückkehrten, ihre Arbeitszeiten oder Aufgaben anpassen.
Ein spezieller diagnostischer Marker zum Nachweis von Long COVID steht bisher nicht zur Verfügung, ebenso wenig eine Konsensus-Definition oder allgemein anerkannte diagnostische Kriterien. Als potenzielle Pathomechanismen werden unter anderem das direkte Eindringen des Virus in Nervenzellen, Entzündungsprozesse und Störungen der Blut-Hirn-Schranke diskutiert. Möglicherweise können auch traumatische Erfahrungen in der Kindheit (z. B. Missbrauch) die Anfälligkeit erhöhen.
Koronare Herzerkrankung, Hypertonie, Schlafapnoe und Adipositas verschlechtern den neuropsychiatrischen Befund nach einer akuten Infektion. Impfungen senken das Risiko für Long COVID und somit auch das Auftreten kognitiver Dysfunktion. Metaanalysen ergaben, dass eine schwere Coronaerkrankung, insbesondere bei stationärem Therapiebedarf, mit einem schlechteren mentalen Ergebnis einhergeht. Allerdings werden von einem leichten Verlauf Betroffene nicht unbedingt verschont. Inzwischen manifestiert sich die Mehrzahl der Infekte leicht bis moderat, wobei die kognitiven Folgen noch unklar sind. Eine Metaanalyse von 54 Studien ergab im Schnitt sechs Monate nach einer nicht schweren Erkrankung im Vergleich zu Gesunden einen geringen, aber signifikanten negativen Effekt auf die Kognition. Häufiger betroffen waren Personen, die zusätzlich unter Fatigue, einer Depression oder Angst litten. Die Autorinnen und Autoren kommen zu dem Schluss, dass ohne psychiatrische Symptome klinisch bedeutsame kognitive Defizite nach leichter bis mittelschwerer akuter Erkrankung unwahrscheinlich sind.
Depressionen und Angststörungen sind während der Coronapandemie häufiger aufgetreten. Manche Studienergebnisse sprechen dafür, dass es sich dabei um ein vorübergehendes Phänomen handelte und die Prävalenz der psychiatrischen Symptome bereits Mitte 2020 auf das präpandemische Niveau zurückging. Andere Arbeiten sprechen für eine Zunahme der Beschwerden in den frühen Jahren der Pandemie. Kein Zweifel besteht darin, dass sie Element von Long COVID sind. Angesichts der variablen neuropsychiatrischen Erscheinungsformen von Long COVID wird eine individualisierte multimodale Therapie empfohlen, am besten durch Spezialisten z. B. aus der Neuropsychologie und Fachleute für Rehabilitation, auch wenn dies selbst in wohlhabenden Ländern nicht immer möglich ist. Die Datenlage für das Vorgehen ist derzeit noch begrenzt. Die beste Evidenz liefern Fallberichte und kleine offene Studien.
Achtsamkeitstraining als nichtmedikamentöser Ansatz
Bei kognitiver Dysfunktion empfehlen die WHO und die American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation eine kognitive Rehabilitation und Selbstmanagementstrategien. Als nichtmedikamentöse Ansätze bieten sich kognitive Verhaltens- sowie Akzeptanz- und Commitmenttherapien an. Auch Achtsamkeitstraining und Unterstützung durch ebenfalls Betroffene sind hilfreich. Die Evidenz beruht vor allem auf Fallberichten und kleinen offenen Studien.
Auch zur medikamentösen Behandlung gibt es bisher kaum Daten. Eine randomisierte, kontrollierte Arbeit ergab, dass SSRI im Verlauf von acht Wochen die depressiven Symptome bei Long COVID bessern. Gegen die chronische Erschöpfung hilft oft niedrig dosiertes Naltrexon. Der Opiatantagonist wirkt wahrscheinlich auch immunmodulatorisch und antiinflammatorisch. Beiden Mechanismen wird eine ätiologische Rolle zugeschrieben. Inzwischen wurden auch Leitlinien zu Long COVID publiziert. Sie zielen vor allem darauf ab, die psychiatrische Belastung, Funktion und Lebensqualität zu bessern.
Quelle: Aretouli E et al. BMJ 2025; 390: e081349; doi: 10.1136/bmj-2024-081349
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).


