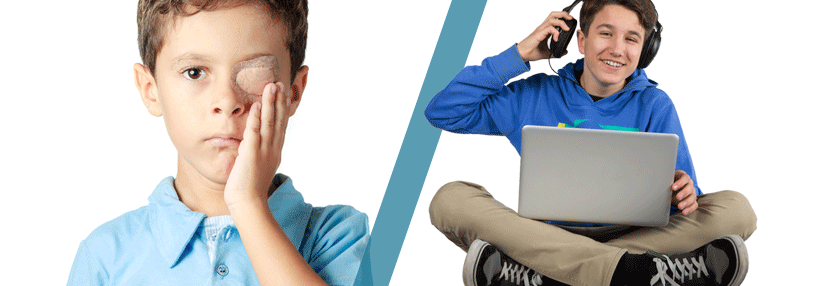
Sehschwäche mit weitreichenden Folgen
 Als Amblyopie bezeichnet man eine zumeist einseitige Sehschwäche, die u. a. mit verminderter Kontrastempfindlichkeit, schlechter räumlicher Orientierung und reduziertem Stereosehen einhergeht.
© Jordi Mora - stock.adobe.com
Als Amblyopie bezeichnet man eine zumeist einseitige Sehschwäche, die u. a. mit verminderter Kontrastempfindlichkeit, schlechter räumlicher Orientierung und reduziertem Stereosehen einhergeht.
© Jordi Mora - stock.adobe.com
Als Amblyopie bezeichnet man eine zumeist einseitige Sehschwäche, die u. a. mit verminderter Kontrastempfindlichkeit, schlechter räumlicher Orientierung und reduziertem Stereosehen einhergeht. Sie entsteht durch abnorme visuelle Erfahrungen in der sensitiven Phase der kindlichen Sehentwicklung. Mögliche Ursachen sind Schielen, unterschiedliche Refraktionswerte beider Augen oder Deprivation z. B. durch eine Katarakt bzw. Trübungen der Hornhaut, was ein unscharfes oder fehlendes Bild auf der Netzhaut zur Folge hat. „Die Diskrepanz zwischen den Bildern jedes Auges (…) führt dazu, dass Informationen des schwächeren Auges zerebral unterdrückt werden“, führt Prof. Dr. Anja Eckstein von der Augenklinik am Universitätsklinikum Essen im Skript zu ihrem Vortrag aus. Dadurch komme es zur verminderten Sehentwicklung und damit schlechteren Sehfunktion.
Prävalenz der Amblyopie liegt weltweit bei 1–2 %
Laut der Gutenberg-Gesundheitsstudie soll die Prävalenz der Amblyopie in Deutschland bei 5,6 % liegen. Diese Angabe hält Prof. Dr. Wolf Lagrèze von der Klinik für Augenheilkunde am Universitätsklinikum Freiburg für falsch. In der Arbeit wurden nämlich Erwachsene untersucht, und immer dann, wenn man kein Korrelat für eine Visusminderung fand, hat man retrospektiv die Diagnose Amblyopie gestellt, kritisierte der Kollege. Weltweit betrage die Prävalenz 1–2 %.
In einer niederländischen Arbeit, in der man 601 gesunde Kinder im Alter zwischen 12 und 18 Monaten orthoptisch untersucht hatte, lag die Häufigkeit von Strabismus bei 1,6 % und die der Amblyopie sogar nur bei 0,3 %. Wahrscheinlich entwickelt sich eine Amblyopie erst später und nicht so häufig wie bis lang angenommen, kommentierte Prof. Lagréze.
Amblyopie als Marker
Amblyopie ist womöglich Ausdruck einer allgemeinen Entwicklungsstörung. Eine Analyse von mehr als 100.000 Datensätzen der UK-Bio-Bank ergab, dass schwachsichtige Menschen häufiger eine Hypertonie (Odds Ratio, OR, 1,3), einen Diabetes (OR 1,3) oder einen Myokardinfarkt (OR 1,4) entwickeln. Auch ihr Sterberisiko ist erhöht (OR 1,4). Ob die Amblyopie behandelt war oder nicht, spielte dabei keine Rolle.
Um Amblyopie zu verhindern, hat man in Deutschland ein Sehscreening etabliert, das von den Kinder- und Jugendärztinnen und -ärzten durchgeführt wird. Es startet bei der U2/U3 mit dem sog. Transilluminationstest und wird von der U4 bis zur U7 mit dem Brückner-Test fortgesetzt. Der erste Visustest erfolgt bei der U7a im Alter von 34 bis 36 Monaten mit kinderkonformen Symbolen. Es gibt jedoch erhebliche Zweifel, dass dieses deutsche Konzept sinnvoll und kosteneffektiv ist.
So konnten die Autorinnen und Autoren der Studie EUSCREEN bereits 2002 aufgrund ihrer Ergebnisse feststellen, dass ein zweizeitiges Amblyopiescreening im Alter von vier sowie fünf Jahren die beste Kosten-Nutzen-Relation hat. Entsprechend wird das Screening z. B. in den Niederlanden durchgeführt. Auch in einer systematischen Übersichtsarbeit von 2021 stellte die Autorin den Nutzwert von Sehtests im Alter unter drei Jahren (ausgenommen der Transilluminationstest) infrage. Den Visus im Alter von drei bis fünf Jahren zu prüfen, sei dagegen sinnvoll und kosteneffektiv. Die US Preventive Service Taskforce vertritt die gleiche Auffassung, für ein Amblyopiescreening bei unter Dreijährigen gebe es keine ausreichende Evidenz. „Das darf man den Kinderärzten auch mal transportieren“, betonte Prof. Lagrèze.
Kritik äußerte der Kollege am gerätegestützten Photoscreening, das in vielen Kinderarztpraxen den Brückner-Test ersetzt hat und teils von den Kassen bezahlt, teils als IgEL angeboten wird. In einer deutschen Studie, in der über 3.000 Kinder im Alter zwischen sechs Monaten und zwölf Jahren mit dem Gerät untersucht wurden, konnten refraktive Amblyopierisiken nur eingeschränkt erkannt werden. Das Gerät war nicht in der Lage, Hyperopie aufzudecken, und Astigmatismus wurde überbewertet, berichtete Prof. Lagrèze. Nur beim Erkennen von Anisometropie sei das Gerät im Vergleich zur Untersuchung durch die Augenärztin oder den Augenarzt „ganz gut“ gewesen.
Brückner-Test erkennt Sehstörungen zuverlässig
Lediglich jedes sechste Kind, das aufgrund eines Photoscreeningbefundes in die ophthalmologische Fachpraxis überwiesen wird, ist tatsächlich behandlungsbedürftig, betonte der Kollege und stützte sich damit auf eigene Berechnungen. Dabei ging er von einer Amblyopieprävalenz von 2 % und einer Spezifität und Sensitivität des Verfahrens von je 90 % aus.
Als „genial einfach“ und zuverlässig bewertete er dagegen den Brückner-Test. Dabei prüft die Ärztin oder der Arzt im (wichtig!) abgedunkelten Zimmer aus verschiedenen Entfernungen mit dem Ophthalmoskop den Fundusrotreflex. Aus 30 cm Entfernung lässt sich so eine Medientrübung feststellen, aus 1 m einen Strabismus und aus 4 m eine Anisometropie. Sensitivität und Spezifität der Methode, um eine Refraktionsdifferenz von 1,5 D zu erkennen, liegen bei 100 %. Das Fazit von Prof. Lagrèze: „Sie brauchen eigentlich kein PlusOptix-Gerät.“
Quelle: Kongressbericht 14. Ophthalmologie-Update-Seminar
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).

