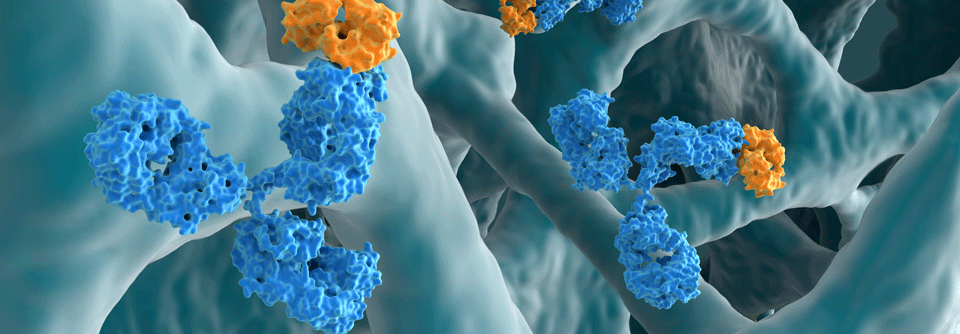CPI nach Stammzelltransplantation – riskant, aber möglich
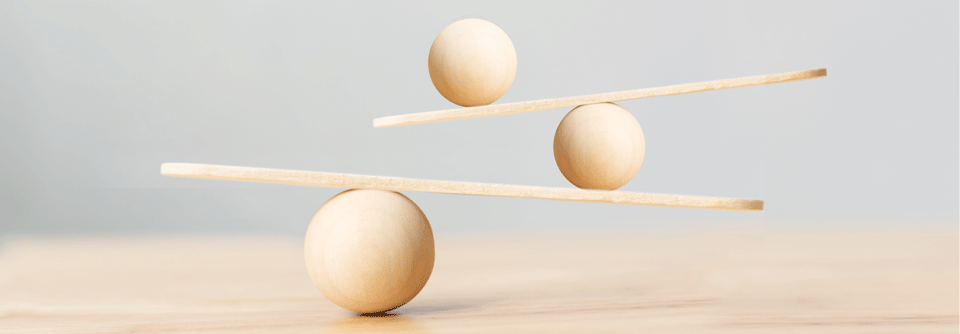 Behandelt man nach einer HSCT mit Immuntherapien, müssen Ärzt:innen Wirkung und Toxizitäten besonders sorgfältig ausbalancieren.
© Monster-Ztudio - stock.adobe.com
Behandelt man nach einer HSCT mit Immuntherapien, müssen Ärzt:innen Wirkung und Toxizitäten besonders sorgfältig ausbalancieren.
© Monster-Ztudio - stock.adobe.com
Checkpoint-Inhibitoren lassen sich nutzen, um Rezidive hämatoonkologischer Erkrankungen nach Stammzelltransplantation zu behandeln, schilderte Prof. Dr. Daniel Wolff, Universitätsklinikum Regensburg, anhand von Fallbeispielen. „Eine PD1-Blockade ist möglich und führt bei einem Teil zur Remission, ist aber mit einer hohen Toxizität verbunden.“ Außerdem erleiden die meisten Patient:innen irgendwann ein Rezidiv.
In einer Studie zu Lymphomerkrankten nach alloHSCT kam es beispielsweise bei neun von 13 Personen mit GvHD in der Vorgeschichte unter PD1-Blockade zu einem Flare-up. Vier Teilnehmende starben sogar deshalb. Auch in weiteren Kohorten fielen Morbidität und Mortalität hoch aus. Der Experte vermutet, dass die von den Transplantationszentren eingesetzten Dosen zu hoch liegen. Bei Transplantatempfänger:innen mit myeloiden Neoplasien schienen die Raten an immunvermittelten Toxizitäten und GvHD unter Decitabin plus Ipilimumab dosisabhängig.
Start im Zweifel mit 10 % der regulären Dosis
Besonders bei Patient:innen mit GvHD in der Vorgeschichte müsse man eine Immuntherapie deshalb eventuell schrittweise beginnen. Der Referent empfahl, mit einem Zehntel der CPI-Standarddosis zu starten. Im Zweifelsfall würde er aber eine Retransplantation gegenüber schweren immunvermittelten Toxizitäten bevorzugen, vor allem für vulnerable Gruppen.
Und wie sieht es bei Zweitmalignomen Transplantierter aus? Generell sollten Ärzt:innen im Falle einer Knochenmarkstoxizität oder Nebenwirkungen an cGvHD-vorgeschädigten Organen erwägen, die Chemotherapiedosis auf 50–75 % zu reduzieren oder die Substanz zu wechseln. Wenn möglich, stellt die Chirurgie die bessere Alternative gegenüber einer adjuvanten Radio- und/oder Chemotherapie dar. Falls Kolleg:innen CPI einsetzen, besteht ein erhöhtes Risiko für Toxizitäten, insbesondere bei kurzem zeitlichen Abstand zu Donorlymphozyteninfusionen oder dem Ende der Immunsuppression sowie einer GvHD in der Vorgeschichte. Gleichzeitig zeigten sich Organe, die von einer cGvHD betroffen sind, möglicherweise besonders responsiv für Immuntherapien.
Therapie von Zweitmalignomen erfordert Zusammenarbeit
Der Referent forderte eine enge Abstimmung zwischen Onkolog:innen und Transplantationszentrum und ein zeitnahes molekulares Tumorboard. Er mahnte: „Wenn Sie im Tumorboard Sekundärmalignome von transplantierten Patient:innen besprechen, muss ein Transplanteur drin sitzen.“ Ist die Intervention kurativ intendiert, bleibt zudem eine prospektive Planung wichtig, um die Induktion eines weiteren Malignoms zu vermeiden.
Quelle: Wolff D. Jahrestagung 2025; Vortrag V244
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).