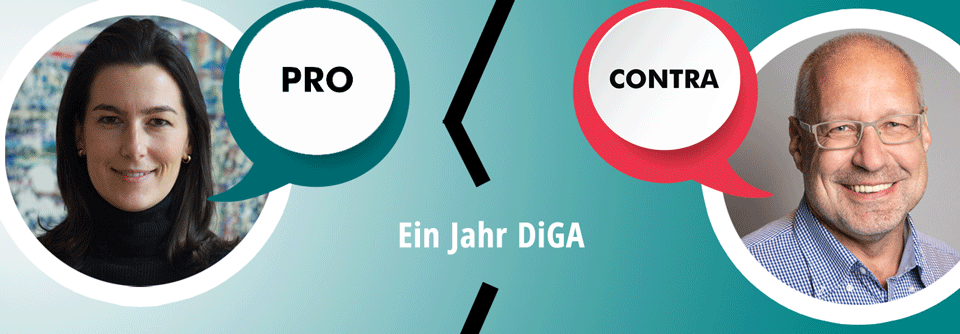
Digitale Gesundheitsanwendungen DiGAs: Apps auf Rezept brauchen mehr Forschung
 Damit DiGA in die Versorgung gelangen können, müssen ihre positiven Effekte in methodisch hochwertigen klinischen Studien belegt werden
© MQ-Illustrations - stock.adobe.com
Damit DiGA in die Versorgung gelangen können, müssen ihre positiven Effekte in methodisch hochwertigen klinischen Studien belegt werden
© MQ-Illustrations - stock.adobe.com
Dabei ist die Liste der zugelassenen Apps inzwischen auf 57 gewachsen. Verschrieben werden können die Apps z. B. bei Reizdarm, Depressionen, Endometriose und vielen weiteren Krankheitsbildern.
Die Zahl der tatsächlichen Verordnungen bleibt allerdings überschaubar. Im Jahr 2024 wurden rund 870.000 der für die Nutzung benötigten Freischaltcodes eingelöst. Das ist im Vergleich zum Vorjahr zwar immerhin mehr als eine Verdopplung, die Deutsche Gesellschaft (DGIM) für Innere Medizin sieht aber dennoch Luft nach oben. Sie warnt davor, dass das Konzept, mit dem Deutschland international Maßstäbe gesetzt habe, zum Stocken kommen könnte. Das liege an einer fehlenden Forschungsförderung und dem umstrittenen Kosten-Nutzen-Verhältnis der Anwendungen.
DGIM fordert gezielte Forschungsprogramme
„Damit DiGA in die Versorgung gelangen können, müssen ihre positiven Effekte in methodisch hochwertigen klinischen Studien belegt werden“, erklärt Prof. Dr. Martin Möckel, Vorsitzender der DGIM-Projektgruppe für DiGA und KI in Leitlinien. „Für viele Hersteller – meist kleinere Unternehmen oder Start-ups – ist das allein jedoch kaum zu stemmen.“
Die DGIM fordert gezielte Forschungsprogramme zwischen öffentlichen Forschungseinrichtungen und Herstellern. Diese könnten etwa beim Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt oder beim Innovationsfonds des G-BA angesiedelt sein.
Presseinformation – Pro Generika




