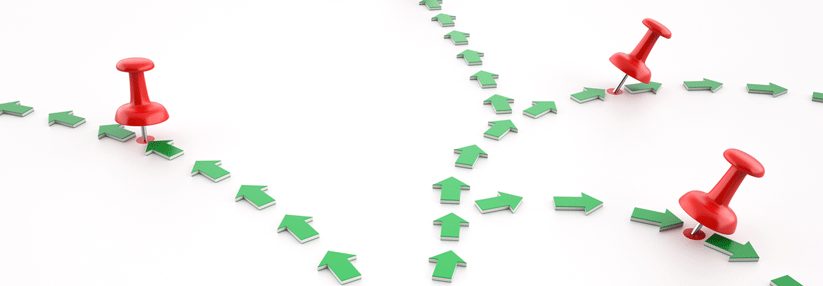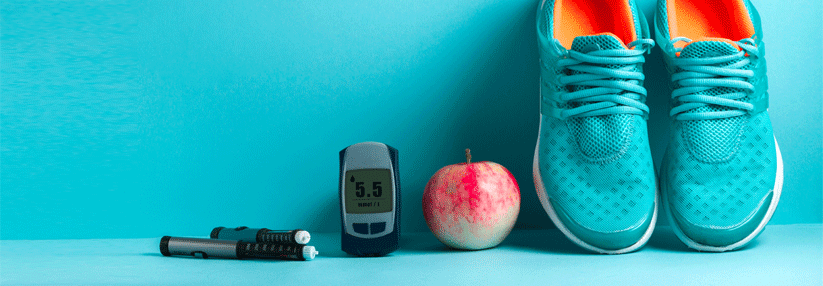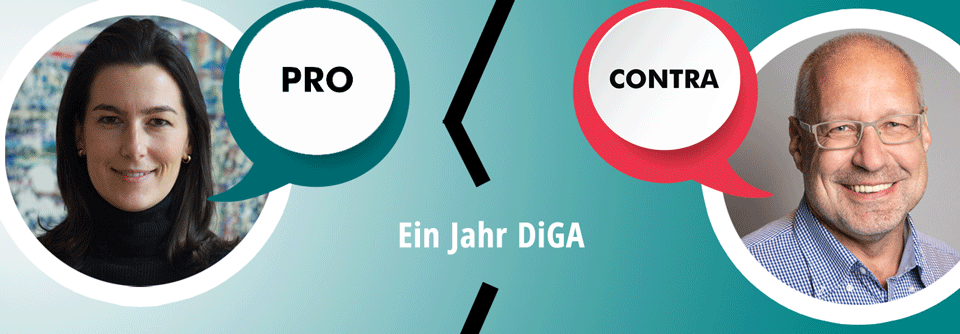
DiGA für Adipositas und Diabetes Hosentaschentherapie kommt voran
 Welche digitale Gesundheitsanwendung (DiGA) lässt sich für gesetzlich Krankenversicherte mit Diabetes und/oder Adipositas guten Gewissens verordnen? Die Deutsche Diabetes Gesellschaft will bei der Beantwortung dieser Frage helfen.
© stock.adobe.com - MQ-Illustrations
Welche digitale Gesundheitsanwendung (DiGA) lässt sich für gesetzlich Krankenversicherte mit Diabetes und/oder Adipositas guten Gewissens verordnen? Die Deutsche Diabetes Gesellschaft will bei der Beantwortung dieser Frage helfen.
© stock.adobe.com - MQ-Illustrations
Welche digitale Gesundheitsanwendung (DiGA) lässt sich für gesetzlich Krankenversicherte mit Diabetes und/oder Adipositas guten Gewissens verordnen? Diese Frage stellen sich niedergelassene Ärztinnen und Ärzte. Die Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) will bei der Beantwortung helfen. Mit der Bewertung von DiGA anhand eines wissenschaftlich erstellten Kriterienkatalogs. Entwickelt wurde dieser von der Fachgesellschaft in Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum Dresden.
Eine treibende Kraft ist dabei Prof. Dr. Peter Schwarz, Präsident der Internationalen Diabetesgesellschaft (IDF). Beim 131. DGIM-Kongress zeigte er das große Potenzial der digitalen Therapieunterstützung auf.
Für die ambulante Behandlung der Adipositas (BMI 30–40 kg/m2) sind bislang zwei DiGA dauerhaft vom BfArM zugelassen worden: Oviva direkt und zanadio. Sie gehören – auch aufgrund des Mangels verschreibungspflichtiger Alternativen – zu den absatzstärksten Medizinprodukten des DiGA-Verzeichnisses, berichtete Prof. Schwarz. Zu 85 % werden sie von Frauen verwendet, meist im Alter von 50+.
Hohe Wiederverschreibungsraten deuteten auf Patientenzufriedenheit und nachhaltige Wirksamkeit hin, erklärte der Dresdner Diabetologe. Das könnte daran liegen, dass eine App auf dem omnipräsenten Handy die richtige motivierende Information zum richtigen Zeitpunkt liefert. Dass die gewünschten Effekte eintreten, etwa ein anhaltend geringeres Gewicht innerhalb eines Jahres, ist mit Studien (RCT) belegt.
DDG-Kriterienkatalog bringt Licht in den DiGA-Dschungel
Die leitlinienkonformen Adipositas-DiGA basieren auf der kognitiven Verhaltenstherapie. Sie nutzen Tagebücher und (teilweise spielerische) Feedback- sowie Coachingsysteme für die Bereiche Ernährung, Bewegung und Verhaltensumstellung. „Das Coole bei den Adipositas-DiGA ist: Sie schließen eine Versorgungslücke“, sagt Prof. Schwarz.
Ziel des Kriterienkatalogs der DDG ist es, DiGA in eine von drei Gruppen einzuteilen: A = sehr wirksam; sollte aktiv empfohlen werden. B = wirksam bei bestimmten Zielgruppen; verschreiben, wenn die/der Patient/in dazu gehört oder danach fragt. C = keine Empfehlung.
Top bewertete DiGA im Bereich Diabetes und Adipositas
Betrachtet werden jeweils Dutzende Kriterien in Kategorien wie Evidenz, Zielsetzung und Produktentwicklung. Bei einem maximal möglichen Wert von 100 Punkten erreichten zanadio rund 70 Punkte und Ovivia direkt 75 Punkte. Noch etwas besser schneiden im Diabetesbereich die DiGA glucura (78) und Vitadio (77) ab. UnaHealth (73) und mebix (70) rangieren in der Nähe. Für die Unterstützung im Selbstmanagement von Typ-2-Diabetes sind Vitadio dauerhaft und glucura, mebix und UnaHealth vorläufig zugelassen. Außerdem gibt es die DiGA HelloBetter für Menschen mit Typ-1- oder Typ-2-Diabetes, die bei Depressionen hilft. „Unsere Idee war: Was über 70 ist, kann man verschreiben, ohne dass man genau nachgucken muss, weil es geprüft und gut ist“, so Prof. Schwarz.
„Als IDF-Präsident träume ich von einer Therapie aus der Hosentasche“, sagt er. So gebe es z.B. ein schwedisches Produkt, mit dem Diabetespatientinnen und -patienten mit Sensor ihre Werte kontinuierlich tracken. Diese werden den Werten von 1.000 anderen Teilnehmenden verglichen. Daraus wird dann eine konkrete Handlungsempfehlung abgeleitet – und festgestellt, ob diese auch eingehalten wird.
"Wir müssen ein Gefühl dafür entwickeln, für welchen Patienten welches Tool am besten geeignet ist.“
„Ja, wir sagen: ,Das wollen wir nicht!‘ Aber denken Sie an Ruanda: 360.000 Menschen mit Diabetes, eine bessere digitale Infrastruktur als in Europa und ein Endokrinologe!“ Solche Tools könnten vielen Menschen in der Welt eine Behandlung ermöglichen. In Indien gebe es den von Diabetologen entwickelten KI-Assistenten „Madhu“. Hierbei nutze die Patientin oder der Patient WhatsApp genutzt, um mit dem eignen Sensor zu kommunizieren.
Anders als bei uns, müssen Kranke in anderen Ländern der Welt von ihren Ärztinnen und Ärzte überzeugt werden, Geld für ihre Behandlung auszugeben. Doch selbst dieser Vorteil führt hierzulande nicht dazu, dass die Menschen beherzigen und anwenden, was ihnen ihre Doktores weitgehend kostenfrei verordnen.
„Das Nicht-Nutzen ist ein wachsendes Problem im DiGA-Sektor“, sagt Prof. Schwarz. „Wir müssen ein Gefühl dafür entwickeln, für welchen Patienten welches Tool am besten geeignet ist.“ Das Beste sei es, die Patentin bzw. der Patient probiere die Optionen aus und sage, was gefällt.
Die Realität in der Arztpraxis
Die Diabetologin Dr. Sandra Schlüter ist im niedersächsischen Northeim niedergelassen. Sie sagt: Wenn man 100 Leuten eine DiGA aufschreibt, wird sie am Ende nur von einem Drittel genutzt. Die restlichen scheitern beim Zugangscodeholen bei der Krankenkasse, beim Freischalten oder Installieren der App und beim Durchhalten.
Sie stellt in ihrer Praxis fest, dass Patientinnen und Patienten, die schon mehrere herkömmliche Schulungen absolviert haben, der Einsatz einer DiGA leichtfällt. Für diese sei es eine Wiederholung. Dagegen würden sich Neulinge schwerer tun. Sie kommen in die Praxis, um sich bei der App-Einrichtung helfen zu lassen oder nachzufragen, ob das, was diese die App meldet, auch vertrauenswürdig sei. Dr. Schlüter warnte die Kolleginnen und Kollegen davor, im Patientengespräch zu erwähnen, dass es z.B. bei einer Adipositas-DiGA um ein Jahreskonzept handelt. „Danach hört keiner mehr zu.“ Besser sei es von Folgeverordnungen zu sprechen.
Nach ihrer Erfahrung helfen DiGA Menschen, die bereit sind, sich selbst kritisch zu hinterfragen und ihren Lebensstil zu ändern, die regelmäßig bei der Therapie mitarbeiten und mit Smartphone und Internet umgehen können. Man dürfe die emotionale Belastung durch solche Tools nicht unterschätzen. So könne etwa das Draufgucken zwanghaft werden. Und für den Fall, dass es mit der DiGA hakt und sie nicht läuft, bräuchten die Nutzenden und ihre Angehörigen einen Notfallplan, was sie machen können.