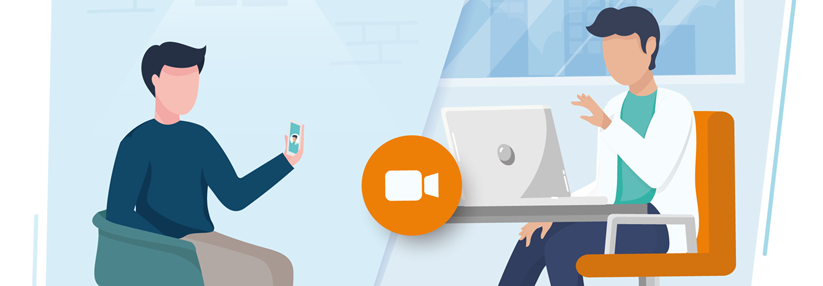Telemedizin: Video-Arzt kommt per Roboter ans Krankenbett
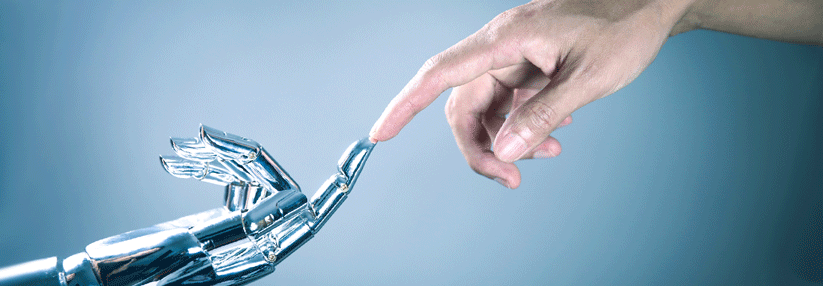 VomNetzwerken könnten Kliniken in entlegenen Gegenden profitieren.
© iStock/xijian
VomNetzwerken könnten Kliniken in entlegenen Gegenden profitieren.
© iStock/xijian
ERIC, eigentlich „Enhanced Recovery after Intensive Care“, ist ein Innovationsfondsprojekt, das die Langzeitfolgen einer intensivmedizinischen Behandlung verringern soll. Im Mittelpunkt steht dabei eine E-Health-Plattform für tägliche Televisiten, über die Ärzte und Pflegekräfte standortunabhängig kommunizieren können.
25 Visitenroboter auf zwölf Intensivstationen im Einsatz
In einem Video auf der Charité-Webseite wird gezeigt, wie ERIC funktioniert. Über einen beweglichen Monitor auf einem fahrbaren Roboter kann sich der Spezialist aus der Projektzentrale in die Situation am Krankenbett einklinken. Er kann sowohl mit den Ärzten und Pflegern sprechen, als auch mit dem Patienten, sofern dieser ansprechbar ist. Per Video- und Zoomfunktion ist sogar der Blick auf die Pupillen des Erkrankten möglich. Eingeschätzt wird der Zustand des Kranken außerdem anhand von Indikatoren, entwickelt von der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.
Angeschlossen an das Projekt sind zwölf Intensivstationen, 25 Visitenroboter sind im Einsatz. Die zentrale Plattform, die Tele-ICU, befindet sich in der Charité. Über sie finden tägliche Televisiten statt, Intensivkonferenzen sowie Abstimmungen zwischen ICU und Verbundkliniken. Thematisiert werden nicht nur akute Fragen, sondern auch, welche Rehamaßnahmen ggf. erforderlich werden. Rund um die Uhr gibt es eine Rufbereitschaft für kritische Fälle.
Wie Professor Dr. Claudia Spies, Direktorin der Klinik für Anästhesiologie mit Schwerpunkt operative Intensivmedizin der Charité, berichtete, zeigen vier von zehn beatmeten Patienten drei Monate nach Entlassung kognitive Beeinträchtigungen, jeder dritte beschreibt Depressionen, 7 % leiden unter einer posttraumatischen Belastungsstörung, jeder vierte hat Probleme bei der Bewältigung von Alltagsaufgaben.
Wichtig seien hier evidenzbasierte Versorgungsstrategien, so die Projektleiterin. Es seien auch „Katalysatoren für Wissen zu generieren“, damit neue Erkenntnisse für Kliniker außerhalb des universitären Betriebs schneller verfügbar werden. ERIC und die Telemedizin seien solche Wissenskatalysatoren.
In dem 2017 gestarteten und vom Innovationsfonds mit 6,8 Mio. Euro geförderten Projekt wurden bis März 1500 Patienten betreut. Beteiligt waren zwölf Intensivstationen in Berliner und Brandenburger Krankenhäusern. Eine Langzeituntersuchung mit 800 Patienten (siehe Kasten) soll Ende Oktober 2020 abgeschlossen sein. Die ERIC-Endergebnisse sind für Ende des Jahres angekündigt.
Hausärzte beobachten die Langzeitfolgen der Intensivbehandlung
Lösung für Kliniken in abgelegenen Regionen
Neues Wissen zu COVID-19 sofort standortunabhängig verfügbar – „ohne ERIC und die Versorgungsoption wäre das nicht möglich gewesen“, so Prof. Spies. Der Vorteil des zentralen Hubs sei, dass man jederzeit einen Experten, der in der eigenen Einrichtung fehlt, z.B. ein Neurologe, hinzuholen könne. 30 bis 40 Visiten seien täglich pro Hub möglich, auch in der Nacht. Bundesweit könnten große Kliniken einen Hub samt Roboter installieren und regionale Netzwerke errichten. Von Vorteil sei das vor allem für entlegene Gegenden mit kleineren Häusern. Die Charité habe die Technik nicht gekauft, sondern Lizenzen hierfür erworben. „Bestätigen sich die Erfolg versprechenden Erkenntnisse, wünschen wir uns, dass das Projekt bald in die Regelversorgung kommt“, sagt Dr. Mani Rafii, Vorstandsmitglied der Barmer, die das Projekt als Konsortialpartner unterstützt. Kleinere Krankenhäuser könnten so die Expertise hochspezialisierter Zentren nutzen. Davon könnten jährlich Zehntausende Patienten profitieren, vor allem bei komplizierten Verläufen, etwa nach Herzinfarkten, Unfällen und Narkosen.Quelle: Pressekonferenz Charité, Barmer, G-BA