
Starre Altersgrenzen greifen nicht 5 Fragen an den Rechtsanwalt zur Schweigepflicht gegenüber Minderjährigen
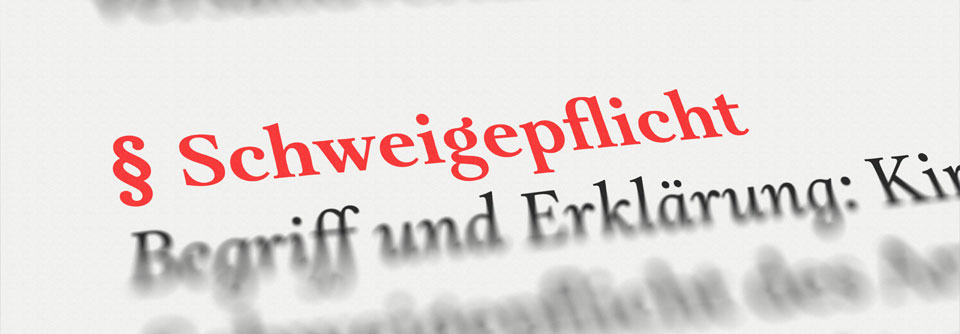 Die ärztliche Schweigepflicht stellt Medizinerinnen und Mediziner im Umgang mit Minderjährigen immer wieder vor Herausforderungen.
© Nico - stock.adobe.com
Die ärztliche Schweigepflicht stellt Medizinerinnen und Mediziner im Umgang mit Minderjährigen immer wieder vor Herausforderungen.
© Nico - stock.adobe.com
1. Ab welchem Alter haben Minderjährige das Recht, selbstständig über die Weitergabe ihrer medizinischen Informationen an die Eltern zu entscheiden?
Eine feste Altersgrenze, wie oft angenommen wird, existiert im deutschen Recht nicht. Entscheidend ist allein die individuelle Einsichtsfähigkeit der minderjährigen Person: Ist sie kraft ihrer geistigen und sittlichen Reife in der Lage, die Bedeutung und Tragweite der Erkrankung, der ärztlichen Maßnahme und auch deren Risiken und Konsequenzen zu erfassen und ihren Willen danach zu bestimmen, ist sie einsichtsfähig. In diesem Fall wird der Behandlungsvertrag allein mit ihr geschlossen, sie ist alleiniger „Herr“ über ihre Daten. Die ärztliche Schweigepflicht besteht dann primär ihr gegenüber. Die betreffende Person kann dem Arzt bzw. der Ärztin also wirksam untersagen, die Eltern zu informieren. Als grobe Orientierung hat sich in der Rechtsprechung eine Altersgrenze von etwa 14 Jahren etabliert. Dies ist jedoch nur eine Faustregel, die eine sorgfältige Einzelfallprüfung niemals ersetzt.
Praxistipp: Verlassen Sie sich nicht auf starre Altersgrenzen. Je komplexer und riskanter der Eingriff, desto höhere Anforderungen sind an die Einsichtsfähigkeit zu stellen.
2. Wie können Ärztinnen bzw. Ärzte die Einsichtsfähigkeit einer minderjährigen Person rechtssicher beurteilen?
Eine solche Beurteilung der Einsichtsfähigkeit erfordert Sorgfalt. Arzt bzw. Ärztin müssen im Dialog mit der Person prüfen, ob diese die wesentlichen Aspekte des Gesprächs wirklich verstanden hat oder ob sie nur Gesagtes wiederholt. Mit offenen Fragen lässt sich das Verständnis überprüfen, z. B.: „Kannst du mir mit deinen eigenen Worten erklären, was wir besprochen haben?“ Oder: „Welche Sorgen oder Ängste hast du bezüglich der Behandlung?“ Oder: „Was denkst du, könnte passieren, wenn wir diese Behandlung nicht durchführen?“ Achtung: Die Beurteilung stützt sich auf die Fähigkeit des Minderjährigen, die Situation rational zu bewerten – nicht darauf, ob man die Entscheidung aus persönlicher Sicht für die richtige hält.
Praxistipp: Dokumentation ist alles! Vermerken Sie in der Patientenakte detailliert, worüber Sie die minderjährige Person aufgeklärt haben, welche Fragen sie gestellt hat und warum Sie zu dem Schluss gekommen sind, dass sie einsichtsfähig ist (oder nicht). Ein kurzer Vermerk wie „Patient ist einsichtsfähig“ genügt nicht. Die Dokumentation ist im Streitfall Ihre wichtigste Absicherung.
3. Was tun, wenn eine einsichtsfähige minderjährige Person die Weitergabe von Informationen an die Eltern untersagt, aber eine Gefährdung des Kindeswohls zu vermuten ist?
Hier kollidieren zwei der höchsten Pflichten von Ärztinnen und Ärzten: die Schweigepflicht (§ 203 StGB) und die Garantenpflicht, Schaden vom Patienten, von der Patientin abzuwenden. Ein Bruch der Schweigepflicht ist nur als Ultima Ratio im Rahmen eines rechtfertigenden Notstands (§ 34 StGB) zulässig. Die Hürden hierfür sind hoch: Es muss eine gegenwärtige, erhebliche Gefahr für das Leben oder die Gesundheit des Kindes bestehen, die nicht anders abgewendet werden kann. Beispiele wären akute Suizidalität oder eine schwere, behandlungsbedürftige und ansteckende Krankheit.
Die ärztliche Handlungskaskade sollte stets der Verhältnismäßigkeit folgen:
- Versuchen Sie eindringlich, die minderjährige Person davon zu überzeugen, die Eltern freiwillig einzubeziehen.
- Wenn das scheitert, können Sie nach dem Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG) die Einschaltung des Jugendamtes in Betracht ziehen, wo Sie sich als Ärztin oder Arzt auch anonymisiert beraten lassen können.
- Nur wenn eine akute, unmittelbare Gefahr droht und keine andere Hilfe erreichbar ist, dürfen Sie ausnahmsweise die Schweigepflicht brechen und die Eltern informieren.
Auch bei der Behandlung von Jugendlichen mit psychischen Erkrankungen oder Suchtproblemen gilt die Schweigepflicht uneingeschränkt. In der Praxis ergeben sich jedoch zwei Besonderheiten: Die Beurteilung der Einsichtsfähigkeit kann anspruchsvoller sein, da die psychische Erkrankung selbst die Fähigkeit zur freien Willensbildung beeinträchtigen kann. Hier ist eine besonders kritische Prüfung geboten. Und: Das Potenzial für eine akute Kindeswohlgefährdung (z. B. Suizidrisiko, schwere Verwahrlosung) ist oft höher, sodass die Notstandsklausel häufiger in Ihrer Abwägung eine Rolle spielen wird.
Praxistipp: Dokumentieren Sie auch hier jeden Schritt Ihrer Abwägung. Warum sahen Sie eine erhebliche Gefahr? Warum waren andere Mittel nicht erfolgreich? Die Güterabwägung muss für Dritte nachvollziehbar sein.
4. Welche rechtlichen Konsequenzen drohen, wenn Ärztinnen oder Ärzte die Schweigepflicht gegenüber einer minderjährigen Person verletzen, und wie können sie sich dagegen absichern?
Eine Verletzung der Schweigepflicht ist kein Kavaliersdelikt. Die Konsequenzen können gravierend sein und umfassen drei Bereiche, nämlich:
- das Strafrecht (mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr, siehe § 203 StGB),
- das Berufsrecht (mit Maßnahmen durch die zuständige Ärztekammer reichen von Rüge bis in sehr seltenen schweren Fällen zum Entzug der Approbation) und
- das Zivilrecht (mit Schadensersatz- und Schmerzensgeldforderungen).
Die beste Absicherung gegen diese Risiken ist eine durchgehend sorgfältige und lückenlose Arbeitsweise.
Praxistipp: Etablieren Sie in Ihrer Praxis einen Standardprozess für den Umgang mit minderjährigen Patienten. Nutzen Sie ggf. standardisierte Aufklärungs- und Dokumentationsbögen, die Sie an den Einzelfall anpassen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Punkte bedacht und dokumentiert werden.
5. Was tun, wenn die getrennt lebenden Eltern unterschiedliche Ansichten zur Behandlung ihres minderjährigen Kindes haben und jeweils Auskunft verlangen?
Bei gemeinsamem Sorgerecht haben grundsätzlich beide Elternteile das Recht auf Auskunft und die Pflicht zur Mitwirkung bei wichtigen medizinischen Entscheidungen. Ein Elternteil kann die Kommunikation mit dem anderen sorgeberechtigten Elternteil also nicht wirksam verbieten. Entscheidend ist die Differenzierung nach der Tragweite der Maßnahme:
- Alltagsentscheidungen wie etwa die Behandlung einer Erkältung kann der Elternteil treffen, bei dem sich das Kind gerade aufhält.
- Wichtige Entscheidungen wie etwa die Planung von Operationen oder der Beginn einer Psychotherapie erfordern die Zustimmung beider sorgeberechtigter Elternteile.
Praxistipp: Fordern Sie die Eltern auf, sich zu einigen. Weigern Sie sich, Partei für eine der beiden Personen zu ergreifen. Teilen Sie beiden Elternteilen sachlich dieselben medizinischen Informationen mit. Bei wichtigen Eingriffen ohne elterlichen Konsens müssen Sie die Eltern darauf hinweisen, dass Sie eine Entscheidung des Familiengerichts herbeiführen müssen. Lassen Sie sich im Zweifel einen Nachweis über das Sorgerecht vorlegen. Und vergessen Sie nicht: Wenn die Eltern uneins sind, liegt die Lösung des Konflikts nicht bei Ihnen. Sie arbeiten in der Medizin, Sie sind nicht vom Familiengericht.
Medical-Tribune-Bericht
