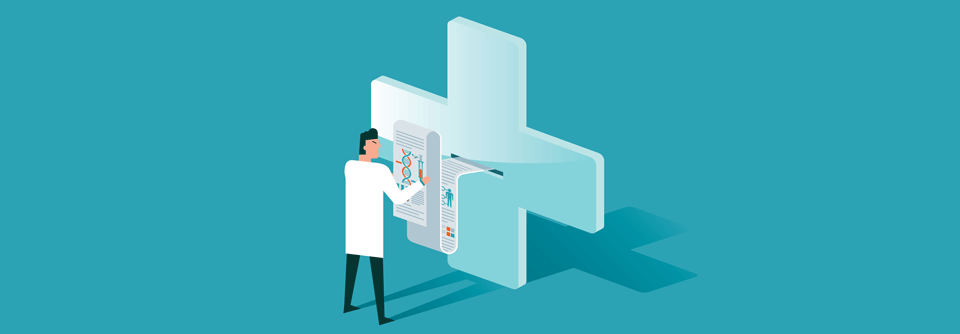Gesundheitsdaten Internisten fordern, Datennutzung für Forschung zu erleichtern
 Aus Datenschutzgründen dürfen routinemäßig erhobene Daten für Forschungszwecke bislang nicht verwendet werden.
© MQ-Illustrations – stock.adobe.com
Aus Datenschutzgründen dürfen routinemäßig erhobene Daten für Forschungszwecke bislang nicht verwendet werden.
© MQ-Illustrations – stock.adobe.com
Nur 600.000 Menschen, das sind weniger als 1 % der über 70 Millionen gesetzlich Versicherten in Deutschland, verfügen bislang über eine elektronische Patientenakte (ePA). Fehlende Nutzerfreundlichkeit und Verzögerungen bei der Vernetzung der Praxen – die Gründe für den Holperstart der ePA, die vor zwei Jahren eingeführt wurde, sind vielfältig. Den Durchbruch will die Regierung jetzt mit dem Wechsel vom Opt-in- zum Opt-out-Prinzip schaffen. Beim Opt-out-Verfahren erhalten Versicherte die ePA automatisch. Wer sie nicht haben will, muss widersprechen, statt wie derzeit aktiv in die Nutzung einzuwilligen. Die Freiwilligkeit bleibt erhalten.
Diese Gesundheitsdaten, zu denen etwa Medikationsplan, Arztbriefe oder Befunde gehören, könnten auch der Forschung dienen, die diesen Datenpool bislang aber nicht nutzen darf. Für das geplante Datennutzungsgesetz fordert die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM) deshalb, auch auf drängende Fragen der Wissenschaft einzugehen. „Das Gesetz muss den Zugriff auf Gesundheitsdaten durch die Forschung gewährleisten“, sagt Prof. Dr. Georg Ertl, Generalsekretär der DGIM. Damit ließen sich die in der ePA gespeicherten Daten aus dem Bevölkerungsquerschnitt, dem Gesundheitssystem oder aus abgeschlossenen klinischen Studien wissenschaftlich nutzbar machen. Denn sie lieferten „wesentliche, auch kurzfristig entscheidende Informationen zur Prävention und Therapie von Krankheiten“, so Prof. Ertl.
Datenschutz schiebt Forschern bislang den Riegel vor
Aus Datenschutzgründen dürfen routinemäßig erhobene Daten für Forschungszwecke bislang nicht verwendet werden, obwohl sogar eine Mehrheit der Patienten dies für sinnvoll hält: Rund 80 % der Menschen in Deutschland würden ihre Gesundheitsdaten der medizinischen Forschung zur Verfügung stellen, drei Viertel von ihnen wollen diese Daten auch in der ePA sehen.
Um Präzedenzfälle für typische Forschungsvorhaben zu beschreiben, die später einheitlich für alle Länder gelten und die Voraussetzungen für den Datenschutz eindeutig festlegen sollen, stimmt sich die DGIM derzeit mit dem hessischen Datenschutz ab.
Bei den Digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA) hat Deutschland zwar die Nase vorn, doch werden diese weiter eher zurückhaltend verordnet. 40 DiGA gibt es derzeit auf Rezept, knapp 200.000 sind bisher verschrieben. Nur 15 dieser digitalen Helfer wurden bislang dauerhaft ins Verzeichnis aufgenommen – v.a. für Depression, Angststörungen und psychosomatische Krankheitsbilder, weiß Prof. Dr. Martin Möckel, Sprecher der DGIM-Arbeitsgruppe DiGA/KI in Leitlinien. Welche konkrete Rolle den digitalen Anwendungen in der Versorgung zukommen soll, ist Ärzten noch unklar. Laut Prof. Möckel sollten der DiGA-Einsatz wie die Medikation im Rahmen des ärztlichen Behandlungsplans erfolgen. Deren „größte potenzielle Wirksamkeit“ sieht er bei regelmäßigen Konsultationen. Aktuell fehle dafür aber eine entsprechende Vergütung, so der Arzt.
Medical-Tribune-Bericht