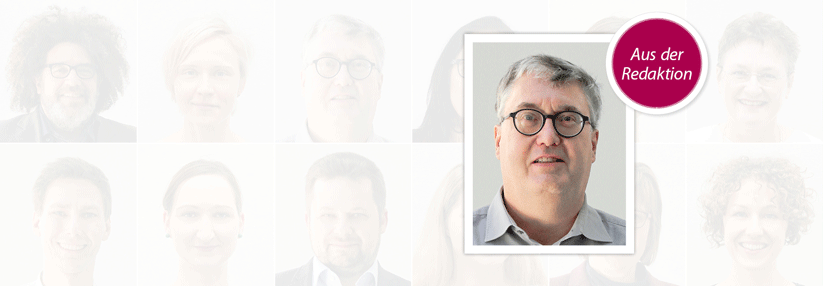Krankenversicherung in der Klemme Reicht das Geld für die Gesundheit?
 Die gesamten Gesundheitsausgaben in Deutschland betragen jährlich etwa 500 Mrd. Euro – 13 % des Bruttoinlandsprodukts. Wie lange können wir uns das noch leisten?
© stock.adobe.com - ARAMYAN
Die gesamten Gesundheitsausgaben in Deutschland betragen jährlich etwa 500 Mrd. Euro – 13 % des Bruttoinlandsprodukts. Wie lange können wir uns das noch leisten?
© stock.adobe.com - ARAMYAN
Etwa 327 Mrd. Euro wird die GKV 2024 für die Versorgung ihrer Versicherten ausgegeben haben. Ein Drittel entfällt auf die stationäre Versorgung, ein weiteres Drittel auf die ambulanten ärztlichen Leistungen samt der verordneten Arzneimittel. Die Gesundheitsausgaben insgesamt, also mit PKV, Eigenanteilen u. a., betragen jährlich etwa 500 Mrd. Euro. Das entspricht 13 % des Bruttoinlandsprodukts.
Wenn Prof. Kolb mit Studierenden der Hochschule RheinMain in Wiesbaden diskutiert, gibt er beispielsweise die Empfehlung: Ja, klebt euch auf der Straße für den Klimaschutz fest, aber kümmert euch auch um eure Sozialversicherungsbeiträge. Damit sie nicht in naher Zukunft die Hälfte der Lohnkosten auffressen.
Mehr Transparenz und ein Primärarztsystem sollen helfen
Den Gesundheitsökonomen muss diese Aussicht als verbeamteter Hochschullehrer persönlich nicht schrecken. Doch auch er nennt die Integration der PKV in die GKV als eine Option zu Stabilisierung der Finanzierung. Ebenso die Integration weiterer Einkunftsarten in die Bemessungsgrundlage der Krankenkassenbeiträge und eine teilweise Änderung der kostenlosen Mitversicherung von Familienangehörigen.
Prof. Kolb empfiehlt ein konsequentes Primärarztsystem zur Patientensteuerung und fordert vor allem mehr Transparenz im System. Die lässt sich z.B. über höhere Zuzahlungen erreichen. Die Erprobung der Patientenquittung sei daran gescheitert, dass es kaum jemanden interessiere, wie viel die Krankenkasse bezahlt, solange den Versicherten Vollkasko ohne Selbstbehalt gewährt wird. Allerdings wendet sich der Ökonom auch gegen ausufernde bürokratische Dokumentationspflichten für die Klinik- und Praxisteams, insbesondere bei der Qualitätssicherung.
Schwedens Modell als Blaupause?
Prinzipiell kommen zudem die Priorisierung und Rationierung von Leistungen in Betracht. Prof. Kolb erwähnte kurz das schwedische Beispiel. Dort wird neben dem Prinzip der Menschenwürde und dem Bedarfs- bzw. Solidaritätsprinzip auch das Prinzip der Kosteneffektivität beachtet. Das habe zu einer Priorisierungsordnung geführt: An erstere Stelle steht die Versorgung lebensbedrohlicher akuter Erkrankungen. Es folgen Prävention und Rehabilitation. Dann kommt erst die Versorgung weniger schwerer akuter oder chronischer Erkrankungen. Und letztlich die Versorgung bei Nicht-Krankheit oder Schaden.
Allokationsentscheidungen über medizinische Leistungen passieren in Alltag ständig, sind aber ethisch diskutabel. Das fängt z. B. schon bei der ärztlichen Zeit statt, die einer Patientin oder einem Patienten gewidmet wird. In der Notfallversorgung wird nicht nur nach Schweregrad entschieden, sondern oft nach dem Motto „wer zuerst reinkommt, wird zuerst behandelt“. Eine Verteilungsfrage kann auch lauten: Wer bekommt das letzte freie Intensivpflegebett?
Ökonomische Interessen vs. Patientenwohl
Auf diese praktischen Konstellationen und den ethischen Überbau ging Dr. Julia König, Onkologin am Universitätsklinikum Heidelberg, ein. Sie verwies auf eine aktuelle Untersuchung zu den wirtschaftlichen Einflüssen auf die Behandlung von Krebskranken. Hier zeigte sich z. B. dass Niedergelassene einen Einkommensanreiz haben, bei Tumortherapien, die sowohl subkutan als auch intravenös verabreicht werden können, die iv-Behandlung vorzuziehen, obwohl den Patientinnen und Patienten möglichst seltene und kurze Aufenthalte lieber wären. Der Grund ist: Die Spritze wird pro Patienten nur einmal im Quartal vergütet, jede iv-Gabe aber einzeln. Das Prinzip der Nutzenmaximierung wird hier zur Frage: Wem nutzt es: der Industrie, der Praxis/Klinik, den Behandelten?
Verteilungsentscheidungen enthalten Werturteile, unterstrich Dr. König. Formale wie inhaltliche Kriterien sollten dabei berücksichtigt werden. Der medizinische Nutzen und die Erfolgsaussichten seine ethisch vertretbare Priorisierungs- und Rationierungskriterien.