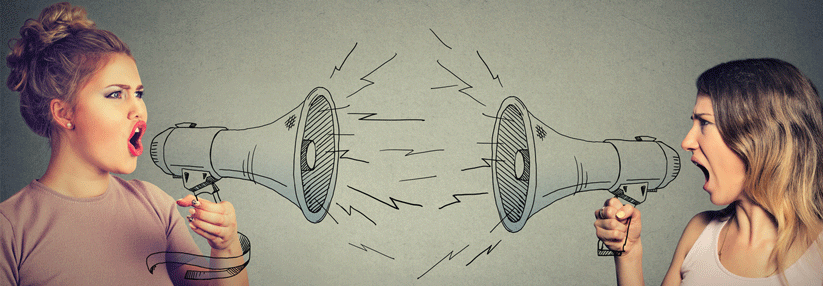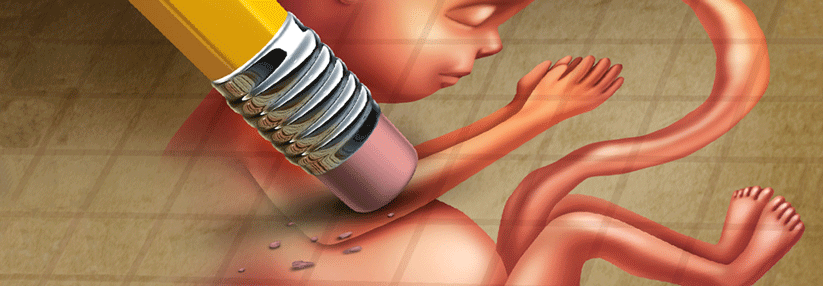
Kritik an § 219a bricht auch nach der Neufassung nicht ab
 Der öffentliche Protest gegen § 219a hat für dessen Abschaffung nicht gereicht. Die Koalition beließ es bei einem Kompromiss.
© Flickr/Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen (CC BY 2.0)
Der öffentliche Protest gegen § 219a hat für dessen Abschaffung nicht gereicht. Die Koalition beließ es bei einem Kompromiss.
© Flickr/Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen (CC BY 2.0)
Die Zahl der Einrichtungen, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, ist in den Jahren von 2003 bis 2017 von 2000 Stellen auf 1200 zurückgegangen. Dazu tragen vermutlich auch Briefe wie dieser bei: „Ich hoffe inständig, dass jede ,Frau‘, die ihr Ungeborenes töten lässt, elendig daran krepiert“, gerichtet an Dr. Christiane Tennhardt, niedergelassene Frauenärztin in Berlin. Im folgenden Absatz wünscht die Absenderin auch der Medizinerin den Tod, weil sie Abbrüche anbietet.
Post mit Schimpftiraden und Drohungen
Nach der Neufassung des § 219a Strafgesetzbuch dürfen Ärzte künftig immerhin auf ihrer Webseite über Abbrüche informieren – aber auch nur das. „So werden Frauen weiterhin bevormundet“, kritisierten Dr. Tennhardt und weitere Referentinnen auf dem Symposium „Abschaffung des § 219a“.
Die Gynäkologin erhält regelmäßig beschimpfende und drohende Briefe und E-Mails. Einschüchtern lässt sie sich davon nicht. „Aber es gibt viele Ärzte, die sagen, in so einem Klima mache ich das nicht.“ Daran werde die Neufassung des § 219a nichts ändern – im Gegenteil: „Es geht den Gegnern bei der Diskussion in Wirklichkeit nicht nur um das Werbeverbot. Es geht um die Frage, ob Frauen abtreiben dürfen oder nicht.“
Die Neufassung besagt, dass künftig die reine Information, dass Abbrüche zum Leistungsspektrum gehören, auf der Praxis-Webseite stehen darf. Für alle weiteren Informationen – wie etwa die angewandten Methoden – muss aber auf eine externe Liste verlinkt werden, z.B. bei der Ärztekammer.
„Wir befürchten, dass eine solche Abtreibungsliste Ärzte abschrecken könnte“, sagt Professor Dr. Ulrike Busch, Ex-Vorstandsmitglied bei Pro Familia. Schließlich seien die Adressen dort auch für radikale Abtreibungsgegner leicht zu finden. „Die Frage ist auch, wie aktuell und vollständig diese Liste sein wird, wenn sich die Ärzte selbst melden müssen.“
Inga Schuchmann von der juristischen Fakultät der Universität Hamburg hält es für verfassungswidrig, wenn sachliche Informationen etwa über Methoden strafbar sind. „Dies ist juristisch ein Eingriff in die Berufsausübungsfreiheit von Ärzten.“ Solche Eingriffe seien zwar nur zulässig, wenn es triftige Gründe dafür gebe. „Das Ziel, ungeborenes Leben zu schützen, wird aber durch reine Informationen zu einem Abbruch nicht beeinträchtigt.“ Zudem dürften keine juristisch milderen Mittel zur Verfügung stehen. Eine anpreisende Werbung für einen Abbruch werde aber bereits durch das ärztliche Standesrecht untersagt – dafür wäre der § 219a gar nicht nötig.
Wenn Schwangere Informationen zu einem Abbruch nur mit Hürden erlangen können, „entsteht der Eindruck: Was du tust, ist nicht in Ordnung!“, sagt Heike Pinne, Leiterin der Pro-Familia-Beratungsstelle Offenbach. Zunehmend kämen Klientinnen, die mit niemandem über ihre Schwangerschaft gesprochen haben. „Viele erwarten bei uns, dass wir versuchen, sie zu überreden.“ Scham und Schuldgefühle bedeuteten aber zusätzliche psychische Belastungen für die Frauen, die sich ohnehin in einer Ausnahmelage befänden.
Bannmeilen zum Schutz von Patientinnen und Ärzten
Hinzu kommen die direkten Belästigungen durch sog. Lebensschützer, die vor Praxen und Kliniken demonstrieren und betroffene Frauen direkt ansprechen. „Für diese Gruppen sind daher die Klagen auf Grundlage des § 219a nur ein Mittel von vielen“, sagt Ulli Jentzsch vom Bildungszentrum apabiz in Berlin, der die Szene seit Langem beobachtet: „Ihr Ziel ist es, Druck auf die Berufsgruppen auszuüben, die Abbrüche durchführen.“ Dr. Tennhardt fordert Bannmeilen, um Ärzte und Patientinnen zu schützen.
Quelle: Kongress „Armut und Gesundheit“