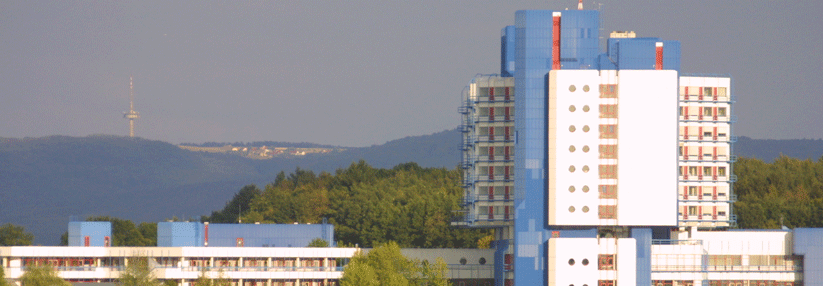Prostitution Mangel an Prophylaxe
 In Deutschland ist es nicht verboten, sexuelle Dienstleistungen anzubieten.
© Photographee.eu – stock.adobe.com
In Deutschland ist es nicht verboten, sexuelle Dienstleistungen anzubieten.
© Photographee.eu – stock.adobe.com
Die Studie „Sexuelle Gesundheit und HIV/STI-Präventionsstrategien und -bedarfe von Sexarbeitenden“ zeigt, dass finanzielle und soziale Benachteiligung sowie Gewalt die Gesundheit von Sexarbeiterinnen und -arbeitern gefährdet. In Auftrag gegeben wurde die vom Bundesgesundheitsministerium geförderte Untersuchung von der Deutschen Aidshilfe (DAH).
80 Menschen in der Prostitution, die aus 23 Herkunftsländern stammen, berichten von ihrer Arbeit und den Erfahrungen mit der gesundheitlichen Versorgung. Unter ihnen sind Personen, die illegale Drogen konsumieren („Beschaffungsprostitution“), trans Menschen, Schwarze Menschen sowie Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen. Ein Drittel aller Teilnehmenden kommt aus einem osteuropäischen Land.
Vier Kernprobleme, die sich negativ auswirken
„Wir haben diese Studie vor zwei Jahren aus der Perspektive und mit den Erfahrungen von 40 Jahren Präventionsarbeit gestartet“, berichtet DAH-Geschäftsführerin Silke Klump. Es sei ein partizipatives Forschungsprojekt, das entscheidende Wissen liege bei den Betroffenen und den Communities selbst. Mit den Ergebnissen des Forschungsprojekts, so hofft Klump, wird die zum Teil sehr hitzige Debatte zum Thema Sexarbeit und Prostitution auf eine sachliche Basis gestellt.
Im Fokus des Projektes stand, den Bedarf der Prostituierten bezüglich sexueller Gesundheit sowie entsprechender Beratungs- und Hilfsangebote herauszufiltern. Es galt aber auch, Hürden zu identifizieren. Ein zentrales Thema war z.B. die Frage nach dem Zugang zur HIV-Expositionprophylaxe. Insgesamt machen die Berichte vier Kernprobleme deutlich, die das Leben von Sexarbeitern erschweren, ihre Gesundheit beeinflussen und sie vulnerabel machen gegenüber Kunden und Dritten:
Gewalterfahrungen und Angst vor Gewalt durch Kunden und Anwohner. Die Gefahr brutaler Gewalttaten besteht auf Arbeit stetig.
Finanzielle Prekarität und existenzielle Not. Berichtet wird über schlechtere Verdienste bei steigenden Lebenshaltungs- und Arbeitskosten. Kunden zahlen seit der Coronapandemie weniger für Sex. Wenn der Verdienst nicht reicht, geraten Prostituierte unter Druck und stimmen eher Sex ohne Kondom zu. Zugleich steigt die Angst, sich mit HIV und sexuell übertragbaren Infektionen (STI) zu infizieren. Verstärkt wird die Sorge durch gerissene Kondome, durch Stealthing (unabgesprochenes Abziehen des Kondoms beim Sex) und das Wissen, dass Kondome nicht zu 100 % schützen.
Belastungen psychischer Art, oft durch erlebte Stigmatisierung. Sexarbeiter können über ihre Arbeit nicht reden, ohne Abwertung befürchten zu müssen.
Kriminalisierung und fehlende Legalität. Sexarbeit ist in Deutschland zwar legal. Trotzdem leben viele Anbieter in der Illegalität. Gearbeitet wird ohne gültige Anmeldung nach Prostituiertenschutzgesetz, in Sperrbezirken oder ohne legalen Aufenthaltstitel und/oder mit Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. All dies ist verbunden mit der Angst vor Polizei und Behörden.
Notwendige Maßnahmen zur Verbesserung der Lage von Sexarbeitenden
In der Studie werden folgende Maßnahmen zur Verbesserung der Lage von Sexarbeitenden beschrieben:
- Unterstützen statt bestrafen
- Prävention muss sich auch an Kunden richten
- Sexarbeitende brauchen mehr Austausch untereinander
- Sozialarbeit und Beratung müssen stärker gefördert werden
- Es braucht mehr Angebote für trans Frauen, drogengebrauchende Frauen, migrantische Frauen und Männer sowie Menschen ohne Papiere
- Sexarbeitende müssen besser erreicht werden
- Flächendeckende Optimierung der gesundheitlichen Angebote nach Prostituiertenschutzgesetz und Infektionsschutzgesetz
- Aufklärung zu PrEP und PEP für alle Sexarbeitende und vereinfachter Zugang
- Zugang zu Krankenversicherung für alle und HIV-Therapie für alle Menschen mit HIV – auch für Sexarbeitende ohne Papiere
- Verbesserung der Behandlungsangebote im Suchtbereich und moderne Drogenpolitik
- Sexarbeitende verdienen gesamtgesellschaftlich Respekt und Wertschätzung
Saarbrücken verdeutliche das Problem der Sperrbezirke anschaulich, sagt Studienleiterin Eléonore Willems. Weil die Innenstadt fast ausschließlich Sperrbezirk sei, bleibe Sexarbeiterinnen nur die Wahl, mit dem Risiko von Geld- oder Haftstrafen zu arbeiten oder ins Auto der Kunden einzusteigen, in Wälder oder zu abgelegenen Orten mitzufahren und sich in Gefahr zu begeben.
„Die meisten Studienteilnehmenden messen dem Thema sexuelle Gesundheit eine hohe Bedeutung bei und wünschen sich mehr Informationen zum Schutz vor HIV und anderen sexuell übertragbaren Infektionen, insbesondere zur HIV-Prophylaxe PrEP“, sagt Willems. Fast die Hälfte der Beteiligten hatte vor der Studienteilnahme noch nichts von der medikamentösen Schutzmethode gewusst, viele hatten nur vage Kenntnisse. Ein Problem für die Betroffenen besteht darin, dass sie sich nicht trauen, niedergelassenen Ärzten ihren Beruf zu nennen.
Gesundheitsämter bieten zwar Beratung und Testmöglichkeiten nach § 19 Infektionsschutzgesetz an, allerdings nicht flächendeckend, erläutert Dr. Johanna Claass, Ärztin und Leiterin der Fachabteilung Sexuelle Gesundheit in der Sozialbehörde Hamburg. Die PrEP könnten nur größere Gesundheitsämter, die auch ärztlich ausgestattet sind, anbieten. „Wir in Hamburg machen das schon seit 2018 – also schon bevor die PrEP Kassenleistung war. Jetzt bieten wir das vornehmlich für Sexarbeitende an.“ Es gebe die sogenannte PrEP Präventionsberatung, um je nach individueller Situation zu sehen, welche PrEP und Einnahme Sinn mache.
Und es gebe dann die ärztliche Beratung, um sicherzustellen, dass die PrEP korrekt eingenommen werde und keine Kontraindikationen bestehen. Verordnet wird in Hamburg auf Privatrezept, denn in der Regel betrifft es Menschen ohne Sozialversicherung. Aber, so Dr. Claass, für viele sei die PrEP aber mittlerweile unbezahlbar, weil sie ungefähr 50 Euro im Monat koste. „Mein Wunsch wäre, dass alle Gesundheitsämter das anbieten können“, so die Ärztin. Und Willems ergänzt, dass auch die Kostenfrage zu klären ist für Menschen, die sich die PrEP nicht leisten können. Hierzu gebe es verschiedene Ideen, die aber bisher nicht umgesetzt würden.
Fehlender Zugang zur Krankenversicherung
Das bestätigt DAH-Geschäftsführerin Klump. Es gebe die Forderung ja schon lange, dass alle Menschen, die in Deutschland leben, Zugang zu einer Krankenversicherung haben sollen. Das scheitere aber u.a. daran, dass Menschen mit Schulden bei der Krankenkasse nicht wieder versichert werden könnten. Zu klären sei ein regulärer Zugang für alle zum GKV-System, es brauche eine bundesweit gültige Lösung.
„Die Empfehlungen haben das Potenzial, unsere Arbeit zu stärken, unsere Arbeit auszubauen“, zeigt sich die Geschäftsführerin der Aidshilfe optimistisch. Viele Akteure seien angesprochen, nicht nur Aidshilfe und Beratungsstellen, auch der Öffentliche Gesundheitsdienst und die Politik: „Wenn wir diese Empfehlungen ernst nehmen, wenn wir sie umsetzen, dann gibt es eine Chance, dass das Leben, dass die Gesundheit, die sexuelle Gesundheit von Menschen in der Sexarbeit, sich verändern können.“
Quelle: Pressekonferenz Deutsche Aidshilfe e.V.