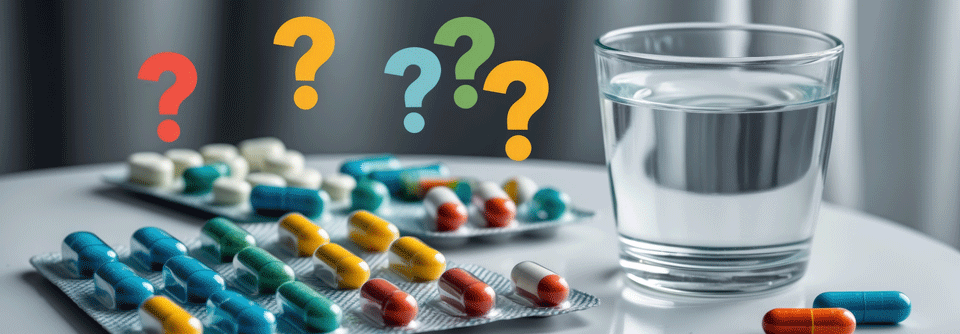
Patientensicherheit Nach Schätzungen jährlich 800.000 Behandlungsfehler in Kliniken
 Ob eine Operation wirklich planmäßig verlief oder ob es dabei zu Fehlern kam, bleibt oft im Dunkeln.
© hin255 – stock.adobe.com
Ob eine Operation wirklich planmäßig verlief oder ob es dabei zu Fehlern kam, bleibt oft im Dunkeln.
© hin255 – stock.adobe.com
Pro Jahr werden in Deutschland nur wenige tausend Behandlungsfehler bestätigt – dabei schätzt der Medizinische Dienst die Dunkelziffer auf über 800.000. Die AOK Bayern gab anhand eines Fallbeispiels einen Einblick in die haftungsrechtlichen Fallstricke und die Fehlerkultur in der Medizin.
Der Fall beginnt unspektakulär: Ein 50-jähriger Patient wird im Januar 2020 mit akuten rechtsseitigen Bauchschmerzen stationär aufgenommen. Ein Röntgenbild liefert keine eindeutigen Hinweise, die Blutwerte deuten allerdings auf eine Entzündung hin. Eine körperliche Untersuchung erfolgt trotzdem nicht, auch die ärztlichen Visiten finden laut medizinischer Dokumentation nur unvollständig statt. Am Folgetag ergibt sich beim Ultraschall dann der Verdacht auf eine akute Cholezystitis mit Gallensteinen. Eine geplante CT wird nicht mehr durchgeführt, stattdessen erfolgt noch am selben Tag die laparoskopische Cholezystektomie. Während der OP stellen die Behandelnden überrascht fest: Eine Eiterspur führt in einen nicht einsehbaren Bereich. Die ab diesem Zeitpunkt offene Operation enthüllt eine Perforation der Appendix, die sofort behandelt wird. Die vorige Entfernung der Gallenblase war nicht notwendig. Die Naht platzt in den weiteren Wochen mehrfach auf, der Patient ist für fünf Monate arbeitsunfähig. Später wird der Fall als grober Behandlungsfehler eingestuft, die Klinik muss eine Entschädigung zahlen.
Das ist nur einer von über 64.000 Fällen, die die AOK Bayern in 25 Jahren ihrer Patientenberatung bearbeitet hat. In rund 28.000 Fällen wurde ein Gutachten beim Medizinischen Dienst veranlasst, in rund 9.000 Fällen bestätigte sich der Verdacht. Statistisch bedeutet das: Seit dem Jahr 2000 gab es täglich einen bestätigten Behandlungsfehler bei AOK-Versicherten in Bayern. Die Krankenkasse erwirkte rund 188 Millionen Euro an Rückzahlungen, etwa für unnötige Behandlungskosten.
Nur ein winziger Anteil der Schadensfälle wird verfolgt
Auch der Medizinische Dienst veröffentlichte kürzlich seine bundesweite Behandlungsfehlerstatistik für 2024. Er erstellte insgesamt 12.304 fachärztliche Gutachten zu vermuteten Behandlungsfehlern. In etwa jedem vierten Fall stellten die Gutachter einen Behandlungsfehler mit Schaden fest. In rund jedem fünften Fall war der Fehler nachweislich ursächlich für den erlittenen Schaden.
Diese Begutachtungszahlen zeigen jedoch nur einen sehr kleinen Ausschnitt des tatsächlichen Fehlergeschehens, betont der Medizinische Dienst. Die Dunkelziffer liege deutlich höher, da nach wissenschaftlichen Studien davon auszugehen sei, dass nur 3 % aller vermeidbaren Schadensfälle nachverfolgt und statistisch erfasst werden. Übertrage man die Ergebnisse internationaler Studien zur Patientensicherheit auf Deutschland, so sei sogar davon auszugehen, dass jedes Jahr 5 % der stationär behandelten Patientinnen und Patienten durch vermeidbare Behandlungsfehler geschädigt werden. Das wären mehr als 800.000 Betroffene. Die Kosten für erneute Eingriffe, Invalidität, Pflegebedürftigkeit oder gar Tod werden auf 15 % der Krankenhauskosten geschätzt – das entspricht einem Betrag von 15 Milliarden Euro. „Die ökonomischen Schäden durch vermeidbare unerwünschte Ereignisse und Fehler werden in Deutschland deutlich unterschätzt“, zitiert der Medizinische Dienst Prof. Dr. Reinhard Busse, Experte für Management im Gesundheitswesen an der Technischen Universität Berlin.
Trotz aller Diskussionen um Patientenrechte, die in Deutschland geführt werden: Es gilt weiterhin die Verschuldenshaftung, erklärte der Fachanwalt für Medizinrecht Benedikt Jansen aus Kempten bei der Pressekonferenz der AOK Bayern. Betroffene müssen beweisen, dass ein Behandlungsfehler vorliegt und dieser ursächlich für einen Gesundheitsschaden ist. Nur in Ausnahmefällen – etwa bei groben Behandlungsfehlern oder Fehlern aus dem Bereich des voll beherrschbaren Risikos – kommt es zur Beweislastumkehr.
Die AOK Bayern fordert deshalb eine Absenkung der Beweislast: Künftig soll eine „überwiegende Wahrscheinlichkeit“ für den Zusammenhang zwischen Fehler und Schaden genügen. Außerdem setzt sich die Kasse für eine verpflichtende Haftpflichtversicherung für Ärztinnen und Ärzte sowie ein zentrales Register für Behandlungsfehler ein.
„Fehler sind menschlich“, sagte Dr. Irmgard Stippler, Vorstandsvorsitzende der AOK Bayern. „Entscheidend ist, dass wir daraus lernen.“ Die Kasse beteiligt sich am Innovationsprojekt „NevER-DE“ – einem Never-Event-Register, das schwerwiegende, grundsätzlich vermeidbare Vorkommnisse bundesweit erfassen soll. Ziel: aus Fehlern lernen, bevor sie sich wiederholen.
Behandlungsfehler sind mehr als nur ein fehlerhafter Eingriff
Bei der Pressekonferenz der AOK Bayern erklärte Benedikt Jansen, Fachanwalt für Medizinrecht aus Kempten, für welche Arten von Fehlern Medizinerinnen und Mediziner haftbar sind:
Aufklärungsmangel: Die Ärztin oder der Arzt informiert die Patientin oder den Patienten vor einem Eingriff nicht über die Risiken und möglichen Komplikationen. Die betreffende Person weiß also nicht, worauf sie sich einlässt. Der Eingriff ist damit rechtswidrig, vergleichbar einer tatbestandlichen Körperverletzung.
Diagnosefehler: Die Ärztin oder der Arzt gelangt zu einer falschen Diagnose oder übersieht z. B. auf einem Röntgenbild einen relevanten Befund.
Übernahmeverschulden: Eine Person weist Krankheitssymptome auf, die einem anderen Fachbereich als dem der behandelnden Person zuzuordnen sind, trotzdem wird die entsprechende Fachrichtung nicht hinzugezogen.
Therapiefehler: Die behandelnde Person führt eine falsche oder unwirksame Therapie durch. Ein Beispiel ist die Implantation einer Hüftprothese in Fehlstellung oder der Verschluss eines falschen Gallenganges bei einer Cholezystektomie. Ein Therapiefehler kann aber auch angenommen werden, wenn eine Ärztin oder ein Arzt nichts tut, obwohl in einer bestimmten Situation ein konkretes Verhalten gefordert wird. Ein Paradebeispiel ist laut Jansen der Befunderhebungsfehler. Ein solcher liegt vor, wenn z. B. eine Blutuntersuchung, eine Bildgebung o. a. nicht durchgeführt wird, obwohl die ärztliche Sorgfalt dies in der Situation erfordert hätte.
Organisationsfehler: Von vornherein ist zu wenig ärztliches oder pflegerisches Personal für zu viele Patientinnen und Patienten eingeteilt, ärztliche Gerätschaften werden nicht regelmäßig gewartet oder desinfiziert oder in der interdisziplinären Notaufnahme eines Krankenhauses hat ausschließlich ein Unfallchirurg oder ein Internist Dienst, ohne dass die andere Disziplin zumindest im Hintergrunddienst zu erreichen ist.
Hygienefehler: Bspw. wird eine Spritze gesetzt, ohne die Hautstelle entsprechend den Regeln der ärztlichen Kunst zu desinfizieren. Es kommt zu einer Infektion.
Ein offener Umgang mit Behandlungs- und Pflegefehlern ist weiterhin keine Selbstverständlichkeit. Selbst nach offensichtlichen Fehlern müsse die Entschädigung oft gerichtlich erstritten werden, berichtet Jansen.
So sei bei einer Patientin bei einer OP eine Schere im Bauchraum zurückgelassen worden – ein klassisches Never Event aus dem Bereich des voll beherrschbaren Risikos. Vor Gericht habe der Oberarzt noch witzig sein wollen und gemeint, als man die Schere entdeckt habe, hätten sie gedacht, dass die Frau sie stehlen wollte.
Quelle: Medical-Tribune-Bericht



