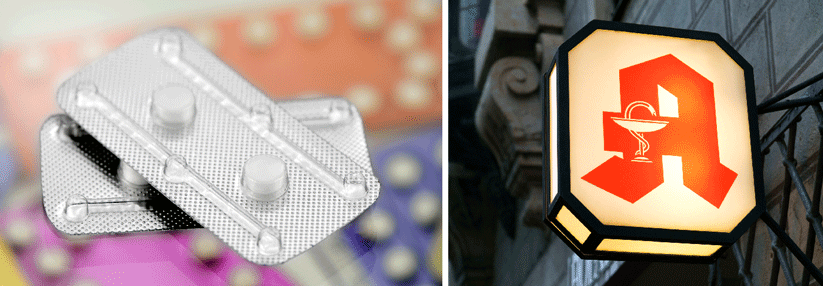
Praxiskolumne Risiken und Nebenwirkungen der „Intervention Kirche“?
 Dürfen wir also überhaupt an seelsorgende Institutionen verweisen, wenn deren internes Qualitätsmanagement so ungenügend ausfällt?
© LisaGageler - stock.adobe.com
Dürfen wir also überhaupt an seelsorgende Institutionen verweisen, wenn deren internes Qualitätsmanagement so ungenügend ausfällt?
© LisaGageler - stock.adobe.com
Da Menschen in einer Krise die mögliche Hilfestellung der Kirche oder des Glaubens vergessen könnten, sei eine kurze Erinnerung daran im Einzelfall hilfreich.
Ich habe diese freundliche Ansprache zunächst als positiv empfunden und wertschätzend entgegengenommen. Generell halte ich es für sinnvoll, lokale Netzwerke zu kennen und zu bilden, um Patientinnen und Patienten auf geeignete Anlaufstellen hinzuweisen. Dennoch denke ich seitdem immer wieder darüber nach, wie man mit dem Thema Kirche und Glauben in der Patientenberatung umgehen kann und soll, wenn dieses Thema von der Patientin oder dem Patienten nicht direkt selbst angesprochen wird.
Für die meisten Kolleginnen und Kollegen gehört es zur Anamnese, zu eruieren, inwiefern sich Patientinnen und Patienten in der Kirche eingebunden fühlen. Aber wie schnell könnten Menschen, die sich in einer Krise befinden, dieses Eruieren als Empfehlung verstehen? Und wäre das schlimm? Wenn es ihnen doch eine Hilfe sein kann?
Im Rahmen eines Fortbildungsseminars über „Resilienz und Grenzen in einer Hausarztpraxis“ wurde das Modell der sieben Säulen der Resilienz thematisiert. Diese Säulen sind: Selbstwahrnehmung, Selbstregulation, Optimismus, Lösungsorientierung, Selbstwirksamkeit, soziale Unterstützung und Zukunftsorientierung. Ohne Zweifel sind das Themen, die der christliche Glaube und die christlichen Institutionen thematisieren. Gerade die soziale Unterstützung im Rahmen von Pflegediensten, Betreuungseinrichtungen, Krankenhäusern und Altenheimen wäre in Deutschland ohne kirchliche Träger nicht denkbar.
Reicht dieses Engagement aber aus, um aktiv an diese Institutionen zu verweisen? Und wenn ja, verweisen wir gleichberechtigt auch an Stellen nichtchristlichen Glaubens? Kennen wir uns damit überhaupt aus? Wie sieht es mit der Evidenz solcher Empfehlungen aus und gibt es einen „First-Line-Glauben“?
Schließlich stehen auch relevante Kritikpunkte an der Institution Kirche im Raum. Die Missbrauchsfälle in der evangelischen und katholischen Kirche sind zahlreich und die Aufklärung dazu ist intransparent und schleppend. Und haben wir auch nur eine Ahnung, wie das in anderen Glaubensrichtungen aussieht?
Dürfen wir also überhaupt an seelsorgende Institutionen verweisen, wenn deren internes Qualitätsmanagement so ungenügend ausfällt? Oder müssten wir die Patientinnen und Patienten an psychotherapeutische Einrichtungen verweisen, bis sich die kirchlichen Institutionen externen Kontrollen öffnen, damit die Sicherheit der „Intervention Kirche“ genauso gut belegt ist wie die Sicherheit eines verordneten Medikaments oder eines Heil- und Hilfsmittels? Oder es ist vielleicht auch genau andersherum, und es ist sogar eine sträfliche Unterlassung, wenn wir die Patientinnen und Patienten in einer Krise nicht an die stützende Gemeinschaft des Glaubens verweisen.
Sie merken es schon, ich bin selbst nicht in der Kirche engagiert. Und ich kenne mich auch nicht mit ihren internen Kontrollstrukturen aus. Auf jeden Fall liegt es mir aber fern, die Institution Kirche als solche zu brandmarken. Ich sehe dort wie gesagt durchaus auch die Chance einer sehr gewinnbringenden sozialen Einbindung. In der hippokratischen Tradition des „primum non nocere“ habe ich aber gerne einen Überblick über die Risiken und Nebenwirkungen von Therapien. Die stehen mir bei diesem Thema aber nicht wie gewohnt zur Verfügung.
Ich frage also mich und auch Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen: Wie sollten wir es in der Praxis mit diesem Thema halten? Ausklammern, anamnestisch erfragen oder aktiv empfehlen – und wenn ja, wem?


