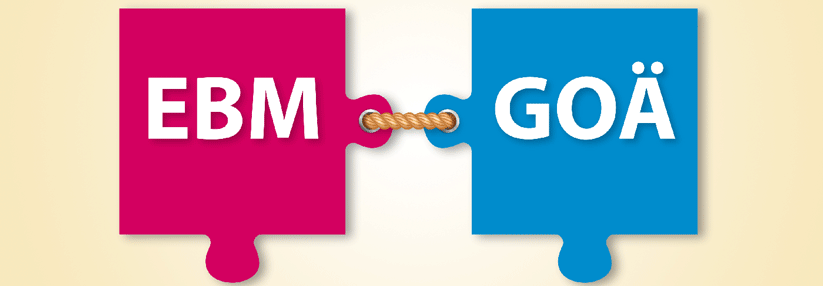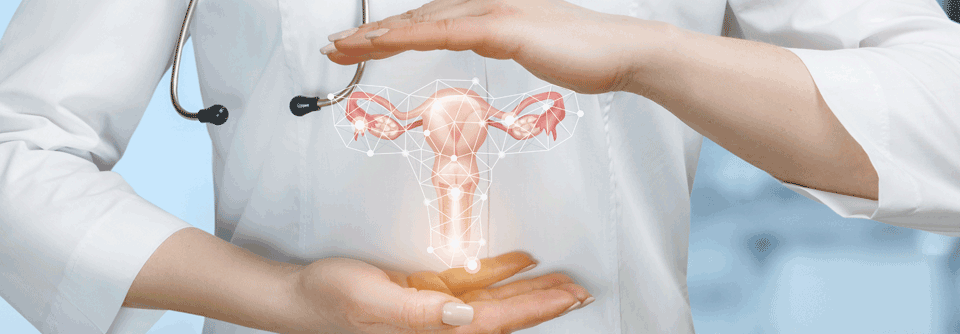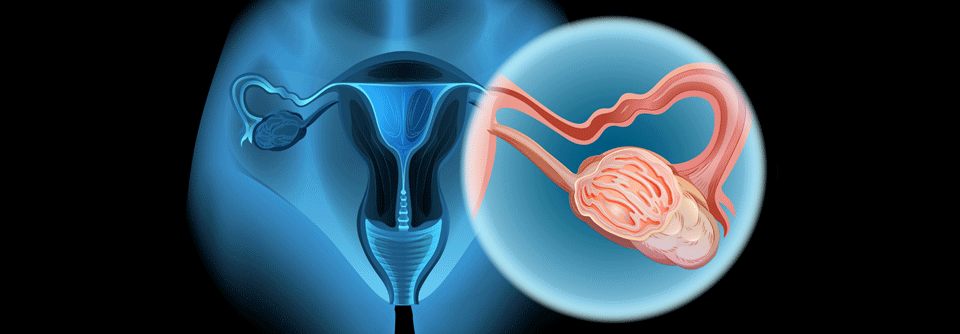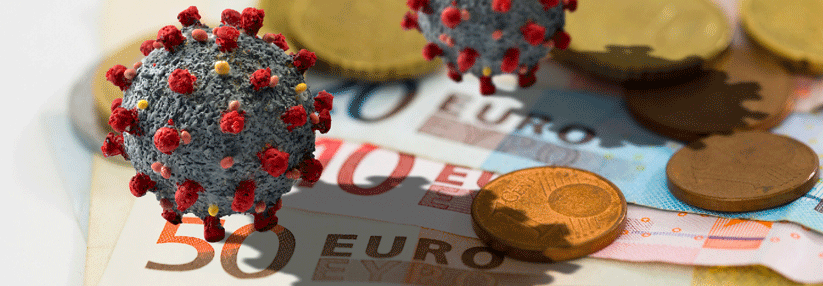
Gynäkologe kehrt GKV-System den Rücken und wird Privatarzt
 Finanziell mag eine Privatpraxis nicht immer attraktiv sein, aber der Lebensqualität ist sie förderlich, sagt Dr. Klaus Günterberg.
© zVg
Finanziell mag eine Privatpraxis nicht immer attraktiv sein, aber der Lebensqualität ist sie förderlich, sagt Dr. Klaus Günterberg.
© zVg
Die Tätigkeit eines Vertragsarztes ist voller Untiefen: Regresse, Honorarkürzungen, Verwaltungsaufgaben, unübersichtliche Gebührenordnung. Und die Eingriffe in die ärztliche Tätigkeit nehmen exponentiell zu. Das sagt Dr. Klaus Günterberg, Gynäkologe in Berlin. Von Freiberuflichkeit könne keine Rede mehr sein; haften ließe man den Vertragsarzt allerdings noch selbst.
Die „Krönung“ dieser Entwicklung ist für den Kollegen Baujahr 1943 die Telematik-Infrastruktur (TI). „In einer gynäkologischen Praxis geht es um intimste Angelegenheiten, vielleicht mehr noch als in anderen Praxen. Wir reden von Kinderwunschbehandlung und Schwangerschaftsabbrüchen, Stuhl- und Harninkontinenz, Sexualität und sexuell übertragbaren Krankheiten – es geht um die vertraulichsten Angelegenheiten des Menschen.“ Gelangen solche Angelegenheiten anderen zur Kenntnis, kann das die Menschen für immer stigmatisieren.
Formal ein kleiner Schritt, real eine große Umstellung
„Die TI ist für mich das Ende der ärztlichen Schweigepflicht. Diese rote Linie will ich unter keinen Umständen übertreten“, sagt Dr. Günterberg. Ein Verkauf der Praxis kam für ihn allerdings nicht infrage. Deswegen beschloss er, seinen Vertrag mit den Krankenkassen zu kündigen.
Formal gesehen braucht ein solcher Schritt nur ein kleines Schreiben an den Zulassungsausschuss. Doch mit dem Tag, an dem Dr. Günterberg seine Beschäftigten über seine Kündigung als Vertragsarzt informierte, begannen drei Monate intensiver Vorbereitung und vieler Worte der Erklärung. Mit am schmerzhaftesten, erzählt der Gynäkologe, war die Einsicht, dass die Praxis absehbar weniger Patienten und weniger Sprechstunden haben würde, und damit weniger Personal braucht. „Ich musste zwei langjährigen Mitarbeitern ihre Entlassung aussprechen“, bedauert der Kollege.
Auch der Umgang mit den Patientinnen fiel nicht immer leicht. „Ich konnte nicht mehr sagen: ‚Dieser Befund muss in einem halben Jahr kontrolliert werden.‘ Ich musste hinzufügen: ‚Dann sind wir aber keine Kassenpraxis mehr.‘“
Dr. Günterberg war es dabei wichtig, seine Entscheidung zu begründen – seinen Patientinnen wie auch Kollegen gegenüber. Deswegen hat er seine Gründe aufgeschrieben, für alle, die es wissen wollen. Die Schreiben stehen noch auf seiner Homepage. Die meisten Patientinnen konnten seine Entscheidung nachvollziehen, erzählt er, und vor allem sein Problem mit dem Datenschutz.
Nachdem sich das bevorstehende Ende seiner Tätigkeit als Vertragsarzt herumgesprochen hatte, war bald im Wartezimmer kein Stuhl mehr frei. Viele Kassenpatientinnen kamen, solange es noch ging. Manche, um sich zu verabschieden, weil sie sich den Privatarzt nicht mehr leisten können würden. Aber auch von denen hätten ihm viele zugesprochen, erzählt Dr. Günterberg. Es habe viele Danksagungen, Blumen und sehr persönliche Geschenke gegeben. „Und ich habe Umarmungen und Tränen erlebt“, erinnert er sich an diese letzte Zeit.
Und wie ging es organisatorisch weiter? Für die PKV-Patientinnen änderte sich nichts. Aber für Selbstzahler musste ein Behandlungsvertrag vorbereitet werden. Und weil diese dann auch nach Preisen fragen würden und allgemeine Hinweise auf die Einzelleistungen in der GOÄ kaum hilfreich sind, habe man eine Liste von Standard-Leistungen mit den sich letztlich ergebenden Preisen erstellt, erzählt der Arzt. „Das Ergebnis erinnerte mich ein wenig an eine Speisekarte.“ Doch das habe sich bewährt.
Für die häufigsten Leistungen wurden zudem Standard-Rechnungen vorbereitet, die sich im Anschluss an die Behandlung an den Einzelfall zeitsparend anpassen lassen. Dann fehlten noch neue Vordrucke für Verordnungen, Labor, Über- und Klinikeinweisungen, und fertig war die Privatarztpraxis.
In der ersten Zeit war die Praxis abgesehen von PKV-Patientinnen aber erst mal leer. Eine ganze Zeit lang. Dann kamen die ersten Kassenpatientinnen als Selbstzahler wieder. Aber weniger als vorher.
Neben der Rechnungsstellung über die Verrechnungsstelle habe sich ein Geldkarten-Lesegerät bewährt. Barzahlung ist auch möglich, die Mitarbeitenden sind den Umgang mit Geld gewohnt. „Bei uns erhält schon immer jede Zahlung eine Rechnungsnummer, seien es Kopierkosten von 50 Cent oder Honorare für Gutachten und IGeL“, berichtet der Kollege. Problematisch bei der Rechnungslegung seien die ärztlichen Fremdleistungen. Dazu brauchte es Absprachen mit dem Labor und eine Erklärung für die Patientinnen. Die bevorzugen nämlich eine Gesamtrechnung.
Die Mitarbeitenden sind auf jeden Fall gut dabei. Schon in der Kassenpraxis habe es eine Umsatzbeteiligung an IGeL gegeben, heute gebe es eine Beteiligung an den Selbstzahler-Umsätzen. Ihr Einkommen habe sich kaum verändert.
Probleme mit vollem Wartezimmer, langen Wartezeiten und fordernden Patientinnen gab es nicht mehr. Die Praxis bot ab der Umstellung weniger Sprechstunden an, aber plante für jede Patientin mehr Zeit ein. Schließlich erwarteten Privat- und Selbstzahler-Patientinnen neben kürzeren Wartezeiten, dass der Arzt sich Zeit für sie nimmt.
Das mit der Zeit habe sich sowieso verändert, sagt Dr. Günterberg. „Wenn ich heute die ständigen seitenlangen neuen Vorschriften für die Vertragsärzte und dazu die Inflation der zugehörigen Abrechnungsziffern sehe, bin ich froh, mich damit nicht mehr belasten zu müssen. Ich lese inzwischen mehr Fachliteratur.“
Rechnungslegung musste neu organisiert werden
Für Anfragen von Kollegen mit der Bitte um Übersendung von Befunden oder Behandlungsberichten ehemaliger Patientinnen hat der Gynäkologe im Computer eine Antwort abgelegt: „Ich kann meine Leistungen nicht mehr den Krankenkassen in Rechnung stellen. Es kosten im vorliegenden Fall Behandlungsbericht, Kopien und Porto x Euro. Bitte klären Sie mit der Patientin die Kostenübernahme.“ Manchen Patientinnen sei es das wert, von anderen höre man dann nichts mehr.
Wirtschaftlich habe sich manches verändert, sagt der Arzt. Die Umsätze der Praxis seien erwartbar deutlich gesunken, die Miete leider nicht. Dafür habe eine Privatpraxis viel weniger Bürokratie und brauche somit weniger Personal. Die Entlassungen, so schmerzhaft sie waren, seien betriebswirtschaftlich richtig gewesen.
Geschwänzte Termine werden auf einmal zum Problem
Hilfsmittel, die zuvor Sprechstundenbedarf waren, gehen jetzt auf eigene Kosten, Akut-Medikamente und Impfstoffe auch. Letztere können den Patientinnen zwar in Rechnung gestellt werden, aber auf Überlagerungen bleibe man sitzen. Und von den Patientinnen nicht wahrgenommene Termine bekomme man zu spüren. Die Gebührenordnung für Zahnärzte kenne eine Säumnisgebühr, die GOÄ leider nicht.
Dr. Günterbergs Fazit sechs Monate nach dem Ausstieg: Wirtschaftliche Aspekte spielen in einer Privatpraxis eine viel größere Rolle als in einer Vertragsarztpraxis. Finanziell sei eine Umwandlung einer Vertragsarztpraxis in eine Privatpraxis in gemieteten Räumen nur mit einem überdurchschnittlichen Anteil an Privatpatienten, einer erheblichen Zahl an Selbstzahlern, ohne Schuldenlast und nur in der Grundbetreuung durchzuhalten.
„Mein Einkommen ist deutlich gesunken. Doch meine berufliche Zufriedenheit und meine Lebensqualität sind erheblich gestiegen“, sagt der Arzt. Und die Entscheidung gegen die TI sei ja wohl auch richtig gewesen, wenn man sich anschaue, wie oft sensible Daten heute in die Öffentlichkeit gelangten.
Dass er in der Coronakrise genauso wie andere Praxen an Patientenverlusten leidet, erschüttert Dr. Günterberg nicht wirklich. Obwohl die Patientenzahlen noch nicht lange sinken, sei das schon spürbar. Rund ein Drittel weniger seien es. Aber Unterstützung brauche er keine, sagt er. Zumal er lieber trockenes Brot essen würde, als die Löhne seiner Mitarbeitenden nicht auszuzahlen. Aber so weit scheint es nicht zu kommen.
Medical-Tribune-Bericht