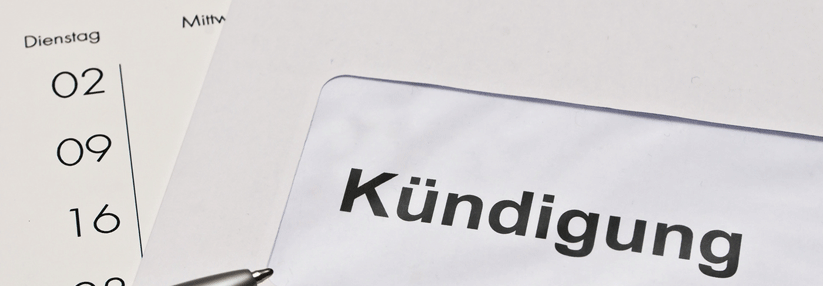
Zwischen Abmahnung und Kündigung Fehlverhalten von Praxis-Mitarbeitenden rechtlich einordnen
 Bei schwerwiegenden Pflichtverletzungen ist auch eine außerordentliche fristlose Kündigung möglich.
© M+Isolation+Photo – stock.adobe.com
Bei schwerwiegenden Pflichtverletzungen ist auch eine außerordentliche fristlose Kündigung möglich.
© M+Isolation+Photo – stock.adobe.com
1. Welche Arten von Fehlverhalten können arbeitsrechtliche Konsequenzen gegen Angestellte nach sich ziehen?
Neben der Härte des Verstoßes ist vor allem entscheidend, welche arbeitsvertraglichen Pflichten konkret geschuldet werden. Es gibt zum Beispiel Pflichtverletzungen in Form der Schlechtleistung im Bereich der zu erbringenden Arbeitsleistung – das ist die Hauptpflicht des Arbeitnehmers – und es gibt Verstöße gegen vertragliche Nebenpflichten. Dazu gehören etwa Verstöße gegen die betriebliche Ordnung wie z. B. Alkoholkonsum am Arbeitsplatz oder häufiges Zuspätkommen, und auch Verstöße gegen Anzeige- und Nachweispflichten, wie etwa bei Krankheit oder Verletzungen des Vertrauensbereichs, beispielsweise bei Diebstahl am Arbeitsplatz.
2. Welche arbeitsrechtlichen Konsequenzen kann man in solchen Situationen ziehen? Und wann und wie wende ich sie an?
Viele werden jetzt natürlich in erster Linie an eine Kündigung des Arbeitnehmers denken. Dabei sind jedoch viele Fallstricke zu beachten. Wichtig ist zunächst, sich klar zu machen, dass eine Kündigung das letzte Mittel ist, das dem Arbeitgeber zur Verfügung steht. Sie ist auch keine Sanktion eines vergangenen Verhaltens, sondern setzt eine negative Zukunftsprognose voraus. Eine gründliche Abwägung aller Einzelheiten des Falls muss zu dem Schluss kommen, dass das Interesse des Arbeitgebers an der Beendigung des Arbeitsverhältnisses gegenüber dem Interesse des Arbeitnehmers auf Fortsetzung überwiegt.
Oft ergibt diese Abwägung, dass zunächst eine Abmahnung des Arbeitnehmers verhältnismäßiger ist. Die Abmahnung sollte daher in aller Regel der Kündigung vorgezogen werden. Bei ordentlichen Kündigungen muss außerdem die Kündigungsfrist beachtet werden.
Bei sehr schwerwiegenden Pflichtverletzungen ist auch eine außerordentliche fristlose Kündigung möglich. Bei dieser ist dem Arbeitgeber aufgrund der Schwere des Fehlverhaltens nicht zuzumuten, die Kündigungsfrist abzuwarten.
Eine Kündigung muss immer in Schriftform erfolgen, per E-Mail oder Messengerdienst ist sie nicht wirksam. Zudem kann sie, wenn sie nicht durch den Inhaber des Betriebes erfolgt, zurückgewiesen werden, außer es ist eine entsprechende Vollmacht beigefügt.
Gibt es in dem Unternehmen einen Betriebsrat, muss dieser in der Regel vor der Kündigung angehört werden. Das Kündigungsrecht kann auch durch besondere Ausschlussgründe, z. B. bei Schwangerschaft oder Schwerbehinderung, eingeschränkt sein.
Je nach Vertragsgestaltung kann neben Kündigung und Abmahnung aber auch eine Vertragsstrafe als arbeitsrechtliche Konsequenz in Betracht kommen. Eine solche Vertragsstrafe für ein bestimmtes Fehlverhalten kann im Arbeitsvertrag vereinbart werden. Im Regelfall entspricht die Strafe einem Bruttomonatsgehalt für die Verletzung einer bestimmten Pflicht, etwa der Geheimhaltungspflicht. Hiermit soll der Arbeitnehmer davor abgeschreckt werden, bestimmte Verpflichtungen zu verletzen. Meist sind das Verpflichtungen, deren Verletzung der Arbeitgeber schadenmäßig nur schwer beziffern könnte, weshalb dann ein Schadenersatzanspruch ausscheidet.
3. Was sind die häufigsten Fehler, die Arbeitgeber bei der Handhabung von Fehlverhalten machen?
Häufig wird recht schnell eine Kündigung ausgesprochen, ohne dass zuvor ein konkretes Fehlverhalten abgemahnt wurde. Und oft werden Abmahnungen ausgesprochen, die nicht den inhaltlichen Anforderungen genügen. Zudem wird immer wieder gegen das Schriftformerfordernis der Kündigung verstoßen oder die Kündigung wird von der falschen Person ausgesprochen. Und es wird oft nicht bedacht, dass das zur Kündigung führende Verhalten im Falle einer gerichtlichen Auseinandersetzung vom Arbeitgeber bewiesen und daher auch gerichtsfest dokumentiert werden muss.
4. Mit welchen Reaktionen muss ich als Arbeitgeber rechnen?
Es muss immer damit gerechnet werden, dass der Arbeitnehmer den Klageweg beschreitet. Dabei sollte man berücksichtigen, dass die Kosten in arbeitsgerichtlichen Verfahren von den Parteien jeweils selbst zu tragen sind, auch im Falle eines Sieges. Es kommt auch vor, dass der Arbeitnehmer nach einer Kündigung unentschuldigt nicht mehr zur Arbeit erscheint. In diesem Fall sollte der Arbeitgeber den Lohn einbehalten. Es ist aber natürlich auch denkbar, dass eine „passgenaue“ Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung für den Zeitraum der Kündigungsfrist vorgelegt wird. Das Bundesarbeitsgericht hat jüngst entschieden, dass in solchen Fällen der Beweiswert einer derartigen Bescheinigung erschüttert sein kann. Das sollte im Einzelfall geprüft werden.
5. An welchem Punkt der Auseinandersetzung ist es klug, anwaltliche Beratung zu suchen?
Bei der Frage nach Konsequenzen von Fehlverhalten am Arbeitsplatz handelt es sich um eine Materie, die stark von den konkreten Gegebenheiten des Einzelfalls abhängig ist. Schnellschüsse verbieten sich daher ebenso wie allzu schematische Betrachtungen.
Um sich mehr Rechtssicherheit zu schaffen und Risiken zu vermeiden, die mit unnötigen Kosten einhergehen, sollte man sich möglichst früh um anwaltlichen Beistand bemühen. So hält man sich außerdem die Möglichkeit offen, den Konflikt durch einvernehmliche Lösungen schon in der Entstehungsphase zu befrieden. Dadurch können unnötige Zeit, Geld und Nerven eingespart werden, die sich sonst womöglich negativ auf den gesamten Betrieb ausgewirkt hätten.
Interview: Jan Helfrich




