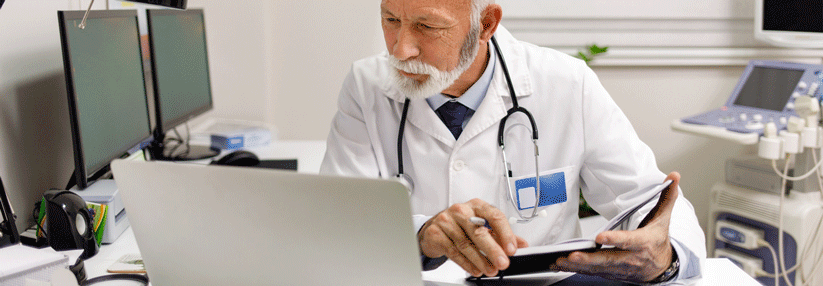Arzneitherapiesicherheit Mehr als ein Plan, aber keine Strategie
 Wann ist welche Pille einzunehmen? Die Antwort sollte der bundeseinheitliche Medikationsplan geben.
© felipecaparros – stock.adobe.com
Wann ist welche Pille einzunehmen? Die Antwort sollte der bundeseinheitliche Medikationsplan geben.
© felipecaparros – stock.adobe.com
Eigentlich spricht alles für den standardisierten Medikationsplan. Der Patient hat schwarz auf weiß, welche verordneten Medikamente er wie einzunehmen hat. Der Facharzt kann sich ein Bild machen, was der Hausarzt verschrieben hat, und den Plan mit Ergänzungen neu ausdrucken. Der QR-Code erlaubt dem Hausarzt den Status flott zu aktualisieren. Und so weiter.
Dennoch läuft es nicht rund. Dr. Philipp Stachwitz, Facharzt für Anästhesiologie und Experte für Digitale Medizin, Berlin, schilderte bei einer Fortbildung der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM) zur Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS) seinen Eindruck: Weder der bundeseinheitliche noch der elektronische Medikationsplan sind bisher in der Versorgung angekommen! Häufig werden Patienten nicht-standardisierte Pläne mitgegeben. Oder Ausdrucke werden handschriftlich ergänzt. Oder die Patienten besitzen mehrere Pläne – und den jüngsten haben sie nicht dabei. Die PIN-Eingabe für den eMedikationsplan ist eine hohe Hürde. Kurz und ungut: Der Pflegeaufwand ist zu hoch, meint Dr. Stachwitz. Die Abgleiche der Pläne in Praxis und Klinik seien komplex. Der Speicher eGK bleibt ungenutzt.
Der Medikationsplan für alle muss online verfügbar sein
Besser könnte es werden, glaubt Dr. Stachwitz, wenn Daten aus Verordnung und Arzneiabgabe, die ohnehin in Praxen, Kliniken und Apotheken anfallen, direkt für die Pläne genutzt werden könnten. Hilfreich wäre es auch, wenn es nur noch einen Medikationsplan für alle gäbe und der Aufwand der Datenpflege passend vergütet würde. Der Arzt hält deshalb den Online-Medikationsplan für den logischen nächsten Schritt. Dieser sei natürlich vor seiner Einführung ausreichend zu testen und zu optimieren.
AMTS ist mehr als das Vermeiden von Interaktionen, betonte Prof. Dr. Daniel Grandt, Vorsitzender der DGIM-Kommission Arzneimitteltherapie-Management & AMTS. Es geht um die Vollständigkeit der Informationen zu Patienten, um Dosierungen, Kontraindikationen, Verträglichkeit sowie potenziell ungeeignete Arzneimittel für ältere Patienten (Priscus-Liste). Hier besteht Verbesserungspotenzial, wie auch Pilotprojekte zeigen. Der Chefarzt der Klinik für Innere Medizin I am Klinikum Saarbrücken nannte als Hindernisse eine inadäquate Risikowahrnehmung und -einstellung der Beteiligten sowie die fehlende Priorisierung und Messung der AMTS – auch wegen nicht vorhandener Tools und Fertigkeiten. Dabei verspricht sich der Sachverständigenrat im Gesundheitswesen viel von der digitalen Unterstützung der Ärzte, um die AMTS zu gewährleisten.
Der Regelfall sieht aber anders aus, wie eine aktuelle repräsentative Studie zeigt. Dr. Karl Blum, Vorstand des Deutschen Krankenhausinstituts, Düsseldorf, stellte erste Ergebnisse vor. Sie basieren auf Angaben von 221 Allgemeinkrankenhäusern. Lediglich jede zweite Klinik (53 %) teilte mit, dass ihr bei der Aufnahme elektiver Patienten ein aktueller und vollständiger Medikationsplan der einweisenden Praxis und somit zumindest ausreichende behandlungsrelevante Informationen vorlägen. Bei Notfallpatienten bejahten das nur 17 % der Häuser.
Quellen für die AMTS
- Newsletter „Drug Safety Mail“ und die Hefte „Arzneiverordnung in der Praxis“ der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft
- kostenpflichtig: „Der Arzneimittelbrief“ und das „Arznei-Telegramm“
- die Arzneimitteldatenbank im Praxisverwaltungssystem; Prof. Grandts Rat: „Fangen Sie mit ,Ihren‘ Arzneimitteln an!“, also den 20 bis 50 Wirkstoffen, die ein Niedergelassener regelmäßig verordnet
- die von der DGIM koordinierte S2k-Leitlinie „Arzneimitteltherapie bei Multimorbidität“
- Krankenhausapotheker
Dem Chirurgen einen Apotheker zur Seite stellen?
Nach Angaben der Kliniken werden Patienten mit AMTS-Risiken auf konservativen Stationen standardmäßig ausschließlich von den behandelnden Ärzten medikamentös betreut. Das antworten jedenfalls 74 % der Krankenhäuser. Bei 22 % werden Apotheker einbezogen. Auf chirurgischen Stationen lauten die Raten 61 % bzw. 32 %. Demnach entscheiden Kollegen, die gut mit dem Skalpell umgehen können, häufig auch allein über pharmazeutische Fragen, unterstreicht Prof. Grandt. Mit einer elektronischen Hilfe ist es ebenfalls nicht weit her. 55 % der Häuser antworteten, dass Verordnungen ausschließlich auf Papier erfolgen. WLAN ist bei einem Drittel noch nicht auf allen Stationen verfügbar. Die Etablierung einer elektronisch unterstützten AMTS-Prüfung verneinten drei Viertel der Kliniken – was Dr. Blum als „erschütternde Zahl“ charakterisierte. Fortbildungen zur AMTS für Ärzte und Pflegekräfte meldete nur jedes dritte Krankenhaus. Nicht einmal jedes zehnte (7 %) gab an, ein schriftliches Konzept zur Verbesserung der AMTS zu haben. Allein Fehlermeldesysteme (CIRS) sind flächendeckend verbreitet (95 %). Fast alle Krankenhäuser (96 %) fänden es (sehr) sinnvoll, wenn sie die Möglichkeit hätten, eine Therapieempfehlung bei Entlassung des Patienten direkt aus dem Krankenhausinformationssystem (KIS) in die Praxis übermitteln zu können. Zwei Drittel würden es begrüßen, wenn es im KIS eine Chat-Funktion zur asynchronen Kommunikation zwischen Klinik und Praxis gäbe. Gefragt, was helfen würde, um wirksame Strategien zur AMTS-Verbesserung einzuführen, nannten 96 % die Refinanzierung und 87 % eine sektorenübergreifende Interoperabilität. Dr. Blum erhofft sich Verbesserungen durch Investitionen, die über den Krankenhauszukunftsfonds – speziell für die Digitalisierung – finanziert werden können.Quelle: DGIMTalk „Arzneimitteltherapiesicherheit“