
Vom Bauchgefühl zur Handlungssicherheit „Ziehen Sie Gewalt als mögliche Ursache in Betracht“
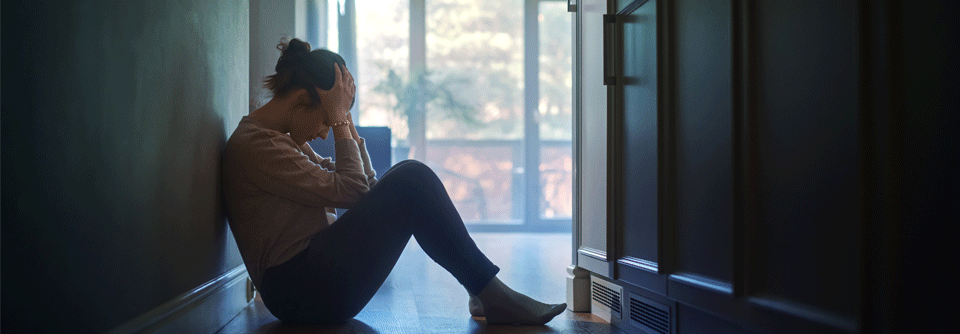 Rund 260.000 Menschen sind im Jahr 2023 Opfer von häuslicher Gewalt geworden.
© Gorodenkoff - stock.adobe.com
Rund 260.000 Menschen sind im Jahr 2023 Opfer von häuslicher Gewalt geworden.
© Gorodenkoff - stock.adobe.com
Rund 260.000 Menschen sind im Jahr 2023 Opfer von häuslicher Gewalt geworden. Dazu kommen über 125.000 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Die Zahlen steigen – und sie zeigen nur das sogenannte Hellfeld. „Man muss sich verdeutlichen, was diese Statistiken eigentlich bedeuten. Sie sagen, dass etwa alle zwei Minuten eine Person in Deutschland Opfer von häuslicher Gewalt wird“, betont Sarah Stockhausen, Fachärztin für Rechtsmedizin im Netzwerk ProBeweis. Das Dunkelfeld sei dabei mit Sicherheit um ein Vielfaches größer.
Das Spektrum an eingesetzter Gewalt reicht dabei weit – von körperlichen Übergriffen bis zu subtiler psychischer Gewalt. Die Definition ist erst seit 2021 bundesweit einheitlich, sie umfasst innerfamiliäre wie partnerschaftliche Gewalt, auch außerhalb gemeinsamer Haushalte.„Im Zentrum steht dabei immer, dass Macht und Kontrolle über eine andere Person ausgeübt wird“, erklärt Stockhausen.
Die Folgen der Übergriffe reichen von akuten Verletzungen bis zu psychischen Langzeitschäden. Ärztinnen und Ärzten kommt hier eine Schlüsselrolle zu, insbesondere in der hausärztlichen Versorgung. „Wir im Gesundheitssystem haben natürlich eine besondere Aufgabe, von Gewalt betroffene Personen zu erkennen und ihnen die entsprechende Hilfe anzubieten“, betont die Rechtsmedizinerin.
Aber warum sprechen Betroffene selten von sich aus ihre Probleme an? Angst, Scham, Abhängigkeit – die Gründe sind vielschichtig. Manche hoffen auf Besserung oder glauben an eine eigene Schuld.
„Viele müssen überhaupt erst selbst erkennen, was da passiert ist und dass sie gerade Gewalt erfahren haben“, erklärt Stockhausen. Auch das Umfeld der betroffenen Personen ist oft überfordert oder hilflos – selbst bei offensichtlichen Anzeichen – und will nicht realisieren, was passiert.
Red Flags für Ärztinnen und Ärzte können auffällige Verletzungen, widersprüchliche Angaben zur Entstehung, verzögerte Konsultationen oder auch das Verhalten von Begleitpersonen sein.
„Es gibt nicht das eine typische Warnzeichen. Und es gibt nicht das eine Signal, was einen sicher darauf rückschließen lassen kann, dass die Person häusliche Gewalt erlebt hat“, so die Rechtsmedizinerin.
Wichtig ist, dass Ärztinnen und Ärzte sensibilisiert sind. Aber auch das Team sollte vorbereitet und geschult werden. „Das ganze Team sollte grundsätzlich über das Thema Gewalt informiert sein und diese Gewaltinformiertheit auch nach außen präsentieren“, sagt Stockhausen.
Dazu gehört zum Beispiel, dass Flyer ausgelegt werden – idealerweise auch in Toilettenräumen –, oder dass interne Codewörter dem Praxisteam den Umgang mit konkreten Situationen erleichtern.
Für die Betroffenen ist elementar, dass ihre Gewalterfahrungen rechtssicher dokumentiert werden. Verletzungen müssen exakt beschrieben und idealerweise fotografisch dokumentiert werden. „Wir nennen das: vom Scheitel bis zur Sohle untersuchen“, so die Empfehlung der Rechtsmedizinerin. Dabei gilt zunächst: Keine Interpretation, reine Beschreibung. Verletzungsart, -form, -größe und Lokalisation müssen exakt erfasst werden. Auch Negativbefunde und Zitate der Betroffenen sollten vermerkt werden, „sodass jemand, der bei der Untersuchung nicht dabei war, sich später genau vorstellen kann, welcher Befund da vorgelegen hat“.
Dazu gehört, dass man diese Befunde sehr genau beschreibt, also nach Kriterien der Rechtsmedizin. „Wir sind da sehr kleinlich. Uns reicht nicht die Beschreibung ‚am rechten Arm ein Hämatom‘, sondern wir wollen wissen, wo genau das Hämatom lokalisiert ist – also ‚an der rechten Oberarminnenseite im mittleren Drittel eine etwa 3 mal 4 cm messende, ovaläre, unscharf berandete, rot-bläuliche Hautverfärbung‘.“
Zu den wichtigsten Ratschlägen der Rechtsmedizinerin gehört, Gewalt als mögliche Ursache für Befunde überhaupt in Betracht zu ziehen. Wenn Sie mehr dazu wissen wollen, wie sich eine Arztpraxis auf Gewaltmedizin vorbereiten kann, welche praktischen und formellen Anforderungen dabei unbedingt berücksichtigt werden müssen und wo eine Praxis an Grenzen stoßen kann, dann hören Sie rein in unsere aktuelle Folge von O-Ton Allgemeinmedizin!
Quelle: Medical-Tribune-Bericht
Mehr zum O-Ton Allgemeinmedizin
O-Ton Allgemeinmedizin gibt es alle 14 Tage donnerstags auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wir sprechen mit Expertinnen und Experten zum Umgang mit besonders anspruchsvollen Situationen in der Praxis.



