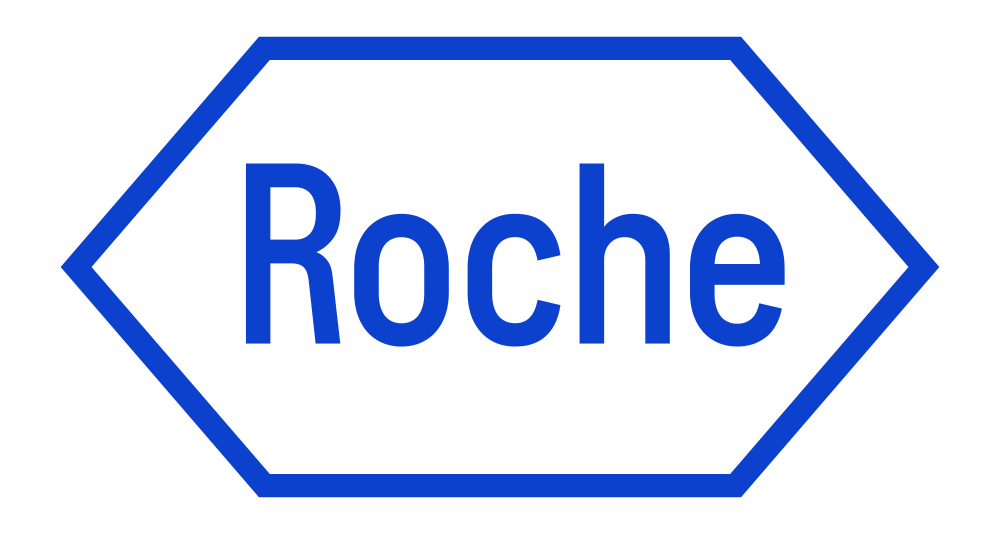„Das Leben planbarer zu machen, hat eine enorme Bedeutung“

Ein Gespräch mit Dr. Kerstin König, Diabetologische Schwerpunktpraxis in Senden, über Chancen und Herausforderungen der neuen Accu-Chek SmartGuide CGM-Lösung im Praxisalltag.
Frau König, das Gefühl, den Glukosewert nicht kontrollieren zu können, zählt zu den Hauptgründen für Diabetes-Distress. Was können CGM-Systeme in diesem Kontext leisten?
Aus meiner Erfahrung unterstützen CGM-Systeme Patient:innen dabei, einen besseren Überblick über ihre Glukosewerte zu erhalten, was für Entlastung im Diabetesalltag sorgen kann. Neue technologische Möglichkeiten, wie die KI-gestützten Prädiktionen von Accu-Chek SmartGuide gehen hier noch einen Schritt weiter, indem sie nicht nur aktuelle Glukose-Werte vermitteln, sondern auch wohin sich diese entwickeln können. Diese Form der Prädiktion ermöglicht ein proaktives Diabetesmanagement und mehr Einfluss auf den Verlauf der Glukose-Einstellung. Dies kann die Selbstwirksamkeit stärken, Diabetes-Distress entgegenwirken und eine erfolgreiche Therapie unterstützen.
Wie genau unterscheidet sich Accu-Chek SmartGuide von klassischen CGM-Systemen?
Der entscheidende Fortschritt liegt in der prädiktiven Qualität der Daten. Die KI-gestützten Funktionen von Accu-Chek SmartGuide liefern mehr als nur Momentaufnahmen oder Trendpfeile, sondern konkrete Aussagen über den wahrscheinlichen Glukoseverlauf in den nächsten Stunden sowie Vorschläge zur Stabilisierung der Werte. Dabei liegt zum Beispiel die Übereinstimmung zwischen dem für die nächsten zwei Stunden vorhergesagten und dem tatsächlich gemessenen Wert bei über 96 %. Solch verlässliche Daten können Patient:innen dabei unterstützen, frühzeitig gegenzusteuern – noch bevor hohe oder niedrige Werte auftreten. Dies kann dazu führen, dass Patient:innen mehr Zeit im Zielbereich verbringen.
Gibt es bestimmte Patientengruppen, die besonders profitieren?
Aus meiner Erfahrung kann eine breite Patientengruppe profitieren. Das gilt besonders für insulinpflichtige Menschen mit erhöhtem Hypoglykämie-Risiko – zum Beispiel mit einer Hypoglykämie-Wahrnehmungsstörung, bei körperlichen Aktivitäten oder in stressbelasteten Berufssituationen. Grundsätzlich können Patient:innen viel von der Prädiktion lernen: etwa im Umgang mit Mahlzeiten oder der Bewertung ihres Glukoseverlaufs nach bestimmten Verhaltensmustern. Letztlich geht es immer darum, den Alltag besser planen und verstehen zu können.
Häufig äußern Patient:innen Sorgen in Bezug auf nächtliche Hypoglykämien. Welche Bedeutung hat das Thema in Ihrer Praxis?
Nächtliche Hypoglykämien sind für viele Menschen mit Diabetes ein stark angstbesetztes Thema. Die Sorge, im Schlaf eine Unterzuckerung zu erleiden und nicht rechtzeitig zu reagieren, kann die Lebensqualität massiv beeinträchtigen. Ich erinnere mich an einen Patienten, der nach einer nächtlichen Hypoglykämie bewusstlos neben der Toilette gefunden wurde. Für ihn war dieser Kontrollverlust und das Gefühl, sich auf den eigenen Körper nicht mehr verlassen zu können, traumatisch. Aus Angst reduzierte er jahrelang seine abendliche Insulindosis deutlich – mit entsprechend negativen Auswirkungen auf die Stoffwechseleinstellung.
Wie kann Accu-Chek SmartGuide in solchen Fällen konkret unterstützen?
Mit der Vorhersage für nächtliche Unterzuckerung konnte der Patient langsam wieder Vertrauen in seine Therapie gewinnen. Die Möglichkeit, vor dem Zubettgehen eine individuelle Risikoeinschätzung zu erhalten und bei Bedarf gegenzusteuern, hat ihm Sicherheit gegeben. So konnten wir gemeinsam die Insulindosis Schritt für Schritt normalisieren. Das ist für mich Therapieanpassung auf Augenhöhe.
Wie reagieren Patient:innen auf die Prädiktionsfunktion?
Wenn ich in der Praxis das Wort „Vorhersage“ erwähne, ist die Aufmerksamkeit sofort da. Die Vorstellung, das eigene Leben – oder zumindest die nächsten Stunden – etwas planbarer zu machen, hat für viele eine enorme emotionale Bedeutung. Das kann dabei helfen, die Akzeptanz für die Therapie zu fördern – gerade in der sensiblen Phase kurz nach der Diagnose.
Gibt es auch Grenzen oder Herausforderungen im Umgang mit der Technologie?
Ja, definitiv. Die Technologie muss eingeordnet und individuell erklärt werden. Manche Patienten sind zu passiv, andere überkompensieren bei erhöhter Prognose. Deshalb vermitteln wir nicht nur die technische Handhabung, sondern auch, wie Prädiktionen sinnvoll eingeordnet werden können – ohne blinden Aktionismus. Wenn das gelingt, nutzen Patient:innen das System zunehmend selbständig, wodurch auch Behandlerteams entlastet werden. Generell kann und soll Technik nicht die ärztliche Einschätzung ersetzen – sie ist aber eine wertvolle Ergänzung.
Welche Veränderungen beobachten Sie durch den Einsatz von Prädiktionen im ärztlichen Alltag?
Wir sehen, dass die Adhärenz spürbar steigt – besonders bei Patient:innen, die sich zuvor stark auf ihr Bauchgefühl verlassen haben oder durch frühere Erfahrungen verunsichert waren. Wenn Prädiktionen nachvollziehbar sind und sich im Alltag bewähren, stärkt dies das Vertrauen und die Akzeptanz. Auch für uns Behandlerteams bedeutet das eine echte Entlastung, denn wir gewinnen wertvolle Zeit und können Patient:innen gezielter beraten. Für uns ist das ein Schritt hin zu einer modernen, datenbasierten Versorgung – mit aktiv eingebundenen Patient:innen und einer nachhaltig veränderten Zusammenarbeit in der Diabetestherapie.