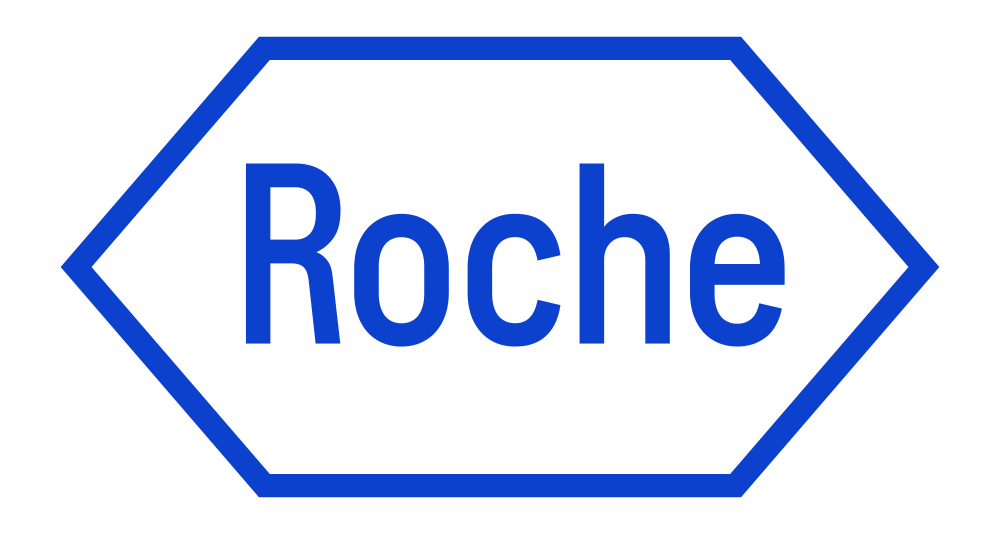Mit prädiktiven Systemen gegen psychische Belastungen bei Diabetes

Nächtliche Hypoglykämien und schwankende Glukosewerte belasten viele Menschen mit Diabetes. Prof. Bernhard Kulzer erläutert, wie KI-gestützte Systeme wie der Accu-Chek SmartGuide helfen können, psychische Belastungen zu verringern und das Selbstmanagement zu verbessern.
Prof. Kulzer, Diabetes ist in erster Linie eine Stoffwechselerkrankung – aber wie wichtig sind psychologische Aspekte für den Therapieerfolg? Und worauf kommt es dabei konkret an?
Psychologische Faktoren spielen eine zentrale Rolle im Diabetes Management. Wie jemand über seinen Diabetes denkt, wie er ihn verarbeitet und in seinen Alltag integriert, hat großen Einfluss auf die Prognose. So kann sich einer Studie zufolge der HbA₁c-Wert um fast 0,4 Prozentpunkte reduzieren, wenn die Betroffenen ein gestärktes Selbstwirksamkeitsgefühl entwickeln. [1] Fest steht: Diabetes ist eine 24/7-Aufgabe, die viel Disziplin und Kraft erfordert. Es gibt Menschen, die gehen recht gut und optimistisch mit der Erkrankung um, viele aber sind überfordert, ängstlich, zwanghaft. Es ist kein Zufall, dass die Lebensqualität von Menschen mit Diabetes im Schnitt deutlich reduziert ist: Viele haben Diabetes-Distress, der wiederum häufig in psychischen Störungen mündet. Depressionen, Ess- und Angststörungen zählen zu den häufigsten psychischen Komorbiditäten.
Was genau überfordert die Menschen?
Drei Faktoren belasten die Betroffenen besonders stark. Erstens: die Angst vor Folgeerkrankungen. Viele Menschen fürchten, durch den Diabetes langfristig nicht mehr sehen oder laufen zu können. Diese Bedrohung ist sehr präsent – und erzeugt Stress. Zweitens: die ständigen Schwankungen des Glukosespiegels. Wenn der Glukosewert unvorhersehbar steigt oder fällt, entsteht bei den Patient:innen das Gefühl, den eigenen Stoffwechsel nicht mehr im Griff zu haben. Der Verlust an Kontrolle verunsichert und wirkt psychisch belastend. Drittens: die Angst vor Hypoglykämien – vor allem in der Nacht. Viele Betroffene empfinden nächtliche Hypoglykämien als besonders bedrohlich, weil sie diese im Schlaf nicht rechtzeitig bemerken können. Die Vorstellung, im Schlaf in eine gefährliche Unterzuckerung zu geraten, ist häufig erschreckend – nicht nur für die Erkrankten selbst, sondern auch für ihre Angehörigen.
Nun gibt es seit geraumer Zeit CGM-Systeme. Wie schätzen Sie den Nutzen in psychologischer Hinsicht ein?
Sowohl CGM- als auch AID-Systeme sind moderne Therapieformen, die Studien zufolge helfen können, Diabetes-Distress zu reduzieren. [2] Patient:innen können den Glukoseverlauf retrospektiv betrachten und erkennen, wie sich beispielsweise die Ernährung, Bewegung oder das injizierte Insulin auf den Glukosespiegel auswirken. Das hilft ihnen, ihren Diabetes und die Therapie zu verstehen und zu optimieren. Alarme können darin unterstützen, Glukoseschwankungen besser in den Griff zu bekommen. Doch diese Funktionen haben Grenzen.
Welche Grenzen sind das?
Die Alarmfunktionen geben bislang größtenteils eine aktuelle Bedrohungssituation wieder, warnen vor einem aktuell zu tiefen oder zu hohen Glukosewert. Das ist gut, ist aber nur die zweitbeste Lösung. Besser wäre, den Patient:innen zu sagen: Du bist in einer Situation, die dazu führt, dass in der nächsten Zeit eine Stoffwechselentgleisung auftreten könnte. Dann können sie frühzeitig reagieren.
Aber die CGM-Systeme arbeiten doch bereits mit Trendpfeilen.
Die Trendpfeile geben an, in welche Richtung sich der Glukosespiegel in den nächsten 15 bis 30 Minuten entwickeln wird. Aber sie arbeiten rein rechnerisch: Sie erkennen den Glukosewert, rechnen die Daten hoch – und geben per Trendpfeil eine einfache Orientierung. Doch die Glukose verändert sich ständig und unterliegt vielen Einflussfaktoren. Viel zielführender ist es, für eine exaktere Vorhersage Daten wie die aktuellen und zurückliegenden Glukosewerte, das Bolusinsulin, die Insulinempfindlichkeit, die Kohlenhydrate oder die Historie bisheriger Unterzuckerungen zu berücksichtigen – hier kommt die Künstliche Intelligenz (KI) ins Spiel.
Wie genau kann KI CGM-Lösungen verbessern?
Die bislang einzige für Menschen mit Diabetes verfügbare Anwendung, die eine KI-gestützte Prädiktion in der Routine bietet, ist der Accu-Chek SmartGuide von Roche. Diese CGM-Lösung wurde KI-gestützt entwickelt, das heißt, sie beruht auf Algorithmen, die an Tausenden von Studiendaten trainiert wurden. Statt einer hochgerechneten Momentaufnahme erhalten die Nutzer:innen eine kontextbezogene Einschätzung. Die Lösung analysiert nicht nur die aktuellen Glukosewerte, sondern bezieht weitere Datenquellen mit ein: ob jemand gegessen oder Insulin gespritzt hat, ob zuletzt Hypoglykämien vorgekommen sind.
Sie ist deutlich genauer und bietet Patient:innen Unterstützung im Sinne einer zweiten Meinung. So entsteht Vertrauen und Sicherheit.
Wie verlässlich sind KI-gestützte Prädiktionen?
Die Prädiktion von Hypoglykämien ist ein gut erforschtes Gebiet. Studien belegen, dass es möglich ist, Hypoglykämien mittels KI-gestützter Algorithmen sicher und verlässlich vorherzusagen: Beim Accu-Chek SmartGuide zeigte die Funktion „Vorhersage für einen niedrigen Glukosewert” eine Sensitivität von 95,2 % und eine Spezifität von 98,9 %. [2]
Hier zeigt sich, dass die Vorhersage auch in der Praxis funktioniert: Patient:innen berichten, die prädiktive Technologie wirke wie ein „Sicherheitsnetz“.
Die prädiktiven Funktionen werden also von den Patient:innen angenommen?
Sie sind definitiv erwünscht. Wir haben unlängst eine Befragung dazu durchgeführt und veröffentlicht (Link zum dt-report): Der Punkt „vorausschauende Warnungen“ lag bei den Patient:innen auf Platz eins der Entscheidungsfaktoren bei der Wahl eines CGMs.
Bei den ebenfalls befragten Ärzt:innen kam dieser Punkt jedoch nur auf den siebten Platz. Woran mag das liegen?
Unter Ärzt:innen herrscht noch eine gewisse Skepsis, ob alle Faktoren, die den Glukoseverlauf beeinflussen, in Algorithmen abgebildet werden können. Das Vertrauen muss noch aufgebaut werden, indem wir beispielsweise mehr über die vorhandene Evidenz sprechen. Zudem sind auch weitere Studien in Planung. Interesse am Einsatz von KI im Diabetes Management ist aber definitiv da: Laut einer anderen Befragung wünschen sich Ärzt:innen und Diabetesberater:innen, mit Algorithmen persönliche Muster im Diabetes Management der Patient:innen zu erkennen.
Nochmal zurück zu den Patient:innen: Wie können denn nun KI-gestützte Prädiktionen psychische Belastungen von Menschen mit Diabetes wirklich reduzieren?
Das versuchen wir gerade in einer Real-World-Studie herauszufinden. Wir untersuchen, wie sich die Anwendung Accu-Chek SmartGuide auf das Wohlbefinden, das Schlafverhalten und die Diabetesbelastung der Patient:innen auswirkt. Wir fragen, was den Nutzer:innen an Accu-Chek SmartGuide gefällt, nach Vor- und Nachteilen im alltäglichen Gebrauch und Verbesserungsvorschlägen.
Das sind zahlreiche Punkte…
…die aber wichtig sind. Technologie lebt von Vertrauen. Sie muss sich im Alltag bewähren und zeigen, dass sie den Patienten wirklich voranbringt. Wir haben schon viele positive Rückmeldungen zum Accu-Chek SmartGuide erhalten – jetzt gilt es, den Patientennutzen und die Verlässlichkeit mit belastbaren und klaren Daten zu belegen.
Quellen
- Lo, C.J., Lee, L., Yu, W. et al. Mindsets and self-efficacy beliefs among individuals with type 2 diabetes. Sci Rep 13, 20383 (2023). https://doi.org/10.1038/s41598-023-47617-4
- Glatzer T, Ehrmann D, Gehr B, et al. Clinical Usage and Potential Benefits of a Continuous Glucose Monitoring Predict App. J Diabetes Sci Technol. 2024;18(5):1009-1013. doi:10.1177/19322968241268353