
MVZ in Private-Equity-Besitz Finanzinvestoren im ambulanten Gesundheitsmarkt
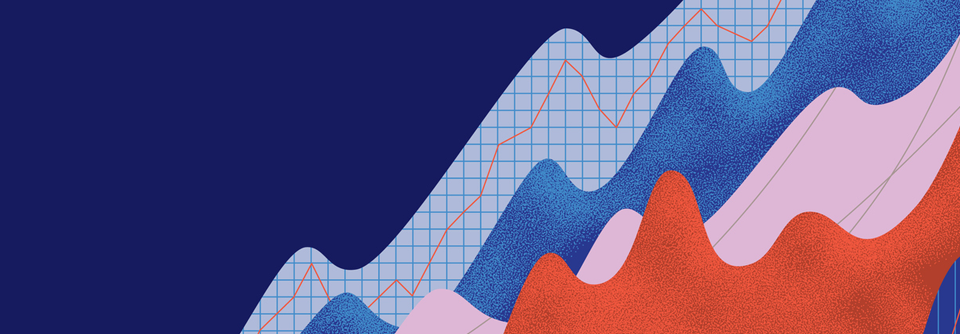 Was bedeuten die Beobachtungen für die Zukunft der ambulanten Versorgung?
© iStock/miakievy
Was bedeuten die Beobachtungen für die Zukunft der ambulanten Versorgung?
© iStock/miakievy
Dr. Scheuplein, Sie haben herausgefunden, dass 17 bayerische Praxisketten in Private-Equity-Besitz sind und 14 davon ihren Sitz in Steueroasen haben. Warum finden Sie es wichtig, das zu wissen?
Das deutsche Gesundheitssystem wird über die Solidargemeinschaft finanziert, deren Beiträge zweckgemäß verwendet werden müssen. Zu diesem Zweck gehört nicht, dass sich Investoren über den Sitz in Steueroasen die Ertragssteuern in Deutschland deutlich verringern. Auch der darüber entstehende Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen möglichen Investierenden wie etwa Ärztinnen und Ärzten, welcher die bisherige bewährte Struktur der ambulanten Versorgung vor einem verzerrten Markt stehen lässt, ist nicht im Interesse der Gemeinschaft. Und dadurch, dass die Steueroasen die Identität der Investoren nicht erkennen lassen und eine Beobachtung des Marktes verhindern, wird auch ein Eingreifen, etwa um eine Konzentrierung oder eine Monopolisierung zu verhindern, unmöglich gemacht.
Was sind eigentlich Private-Equity-Gesellschaften und warum ist ihr Engagement umstritten?
Das Prinzip von Private-Equity-Unternehmen ist nicht schwer zu erklären: Private Equity sind Investmentgesellschaften, die Kapital sammeln, Unternehmen übernehmen und neu ordnen und diese dann wieder verkaufen. Der Verkauf ist immer das Ziel! Üblicherweise arbeiten die Gesellschaften mit Fonds, die über zehn Jahre laufen. Mit dem Wiederverkauf ist also nach fünf bis sechs Jahren zu rechnen. Was die Arztpraxen betrifft, so gibt es diese als Unternehmungen ja bereits schon, die Gesellschaften packen sie also nur noch zu einer Praxiskette zusammen.
Dabei arbeitet Private Equity mit Fremdkapital und ein großer Teil der Käufe wird mit Schulden finanziert. Diese Schulden werden oft auch auf die Unternehmen selbst übertragen. Bei den größeren Unternehmen im Gesundheitsbereich passiert das bereits, bei den kleinen Praxen wird man sehen.
Umstritten sind die Gesellschaften vor allem aber, weil sie rein gewinnorientiert funktionieren. Dabei konterkarieren die kurz- bis mittelfristigen Investitionen das Argument, dass das Gesundheitssystem auf diesem Weg Investitionen erhält. Denn mit dem Verkauf der Unternehmen fließt das Kapital wieder aus dem System heraus. Würde ein anderes großes Unternehmen einsteigen, würde das Kapital zunächst noch investiert bleiben – aber letztlich werden die immer höheren Kaufpreise immer von den Unternehmen getragen.
Private Equity gelten übrigens als die erfolgreichste Investitionsmöglichkeit. Sie bringen die vergleichsweise höchsten Renditen ein, höhere als Immobilien oder Hedgefonds.
Was sind weitere Ergebnisse Ihrer Untersuchung?
Dass alle MVZ-Ketten mit Private-Equity-Eignern eine Doppelstruktur aufweisen: eine Zugangsstruktur, die dem Investor das Gründen von MVZ ermöglicht – häufig sind das kleine Kliniken – und eine Finanzstruktur, die manchmal sogar über mehrere Steueroasen reicht. Bei einem Verkauf wechseln die Finanzstrukturen, die Zugangsstrukturen werden bleiben. Die Leistung des Finanzinvestors besteht darin, die Praxiskette aufzubauen. Die meisten Praxisketten in Deutschland werden dann nach drei bis vier Jahren – sozusagen ganz nach Plan – wieder verkauft. Oft werden sie dann aber nicht in eine solide, nachhaltige Struktur überführt, sondern an den nächsten Investor verkauft. Dadurch vollzieht sich nach und nach der Umbau der Versorgungslandschaft mit vielen Einzelpraxen zu einer mit großunternehmerischen Strukturen. Das haben wir Korporatisierung genannt.
Was befürchten Sie aufgrund Ihrer Beobachtungen für die Zukunft der ambulanten Versorgung?
Finanzinvestoren machen den Hauptteil ihres Gewinn mit dem Verkauf der Praxen: Sie fügen Arztpraxen zusammen und suchen dann jemanden, der einen höheren Preis dafür bezahlt. Dafür braucht man eine Ertragserwartung. Die Praxen müssen also deutlich rentabel sein.
Kritisch ist auch der spekulative Ansatz darin. Denn es ist ja nicht garantiert, dass die Arztpraxen so viel erwirtschaften, dass ein höherer Verkaufspreis damit erzielt werden kann. Investoren können sich verspekulieren. Passiert das, werden wir eventuell auch Insolvenzen im Bereich der ambulanten Versorgung sehen. In einer Untersuchung zu Übernahmen von Private-Equity-Unternehmen außerhalb des Gesundheitswesens haben wir rund 20 % Insolvenzen, Umschuldungen und Betriebsschließungen unter den Unternehmen beobachtet. Das lässt sich nicht 1:1 übertragen, aber es weist auf eine Gefahr hin.
Darüber hinaus fürchten wir eine systematische Ausrichtung der Arztpraxen auf die Auslösung möglichst viele Leistungen, um die Gewinne zu maximieren. Damit würden sich die Kosten im Gesundheitswesen erhöhen.
Grundsätzlich kann eine Korporatisierung und ein Zusammenschluss von Praxen zu Ketten ja sinnvoll sein. Wird dann aber in den MVZ das Angebotsspektrum reduziert, also z.B. nur noch Augenheilkunde angeboten oder sogar nur noch ein Teilangebot aus einem Spektrum, dann widerspricht das der Grundidee des MVZ. Dann merkt man, dass keine medizinische
Idee hinter dem Unternehmen steht, sondern dass das Ziel ausschließlich der höhere Verkaufswert ist. Ähnliches gilt für Überweisungssysteme: Zwischen einer Praxis auf dem Land und einem spezialisierten OP-Zentren in der Metropole kann so etwas sinnvoll sein. Aber wenn die Überweisungen der Optimierung dienen, geht das am Ziel vorbei.
Abgebende Ärztinnen und Ärzte stehen immer öfter vor der Situation, dass sich nur noch Investoren für ihre Praxen interessieren. Oder die Abgebenden bekommen überdurchschnittlich gute Angebote von den Konzernen. Ist also die Entwicklung zu einer ambulanten Versorgung mit lauter Praxisketten in Kapitaleignerhand unausweichlich?
Das Nachfolgeproblem sollte von der Politik und der Selbstverwaltung unbedingt als eine Gestaltungsherausforderung angegangen werden. Dabei geht es einerseits darum, die Bedürfnisse der Nachfolgenden, was z.B. Arbeitszeiten betrifft, zu berücksichtigen. Und gleichzeitig müssen die Abgebenden zu realen Preisen verkaufen können. MVZ können durchaus sinnvolle Organisationsformen sein, um dieses Ziel zu erreichen – dann müssen aber die Finanzinvestoren regulativ eingeschränkt werden. Und zwar auch, um nicht die Preise künstlich nach oben zu treiben.
Welche Schutzmaßnahmen lassen sich in einem marktwirtschaftlichen System legitim ergreifen?
Wir brauchen eine andere Kapitalbasis für MVZ. Das kann etwa über eigene Fonds im Gesundheitsbereich gelingen, zum Beispiel mit einer Sicherung über Versorgungssysteme der Ärzte oder über den Bund oder die KVen, die dann MVZ oder Ketten betreiben, die eben nicht marktwirtschaftlich ausgerichtet sind.
Und wir brauchen vor allen Dingen mehr Transparenz. Auch wir kommen mit unseren Recherchen sozusagen nur bis zu den Cayman Islands – dann wissen wir aber immer noch nicht, wer wirklich sein Geld und seine Interessen in der Sache stecken hat.
Effektiv wäre es, die Gründervoraussetzungen weiter zu differenzieren und die Anteile branchenfremder Investoren auf 49 % zu beschränken. Für Private-Equity wäre die Investition damit weniger interessant. Sie wollen durchregieren und bei Kaufinteressen schnell handeln. Investoren, die sich auf Komplexität einlassen und langfristig investieren, sind mit einer solchen Grenze kaum abzuschrecken. Man würde somit über eine solche Regelung zu stabileren Investoren finden.
Medical-Tribune-Interview










