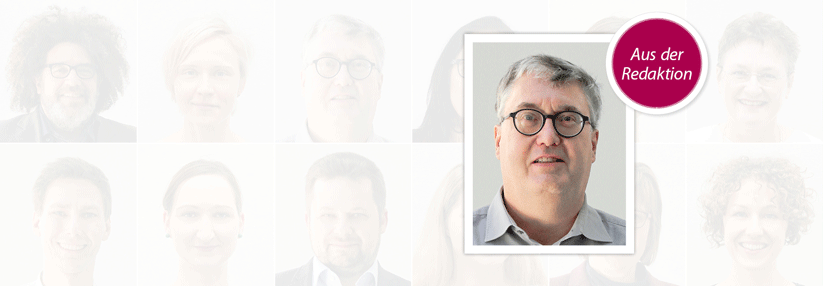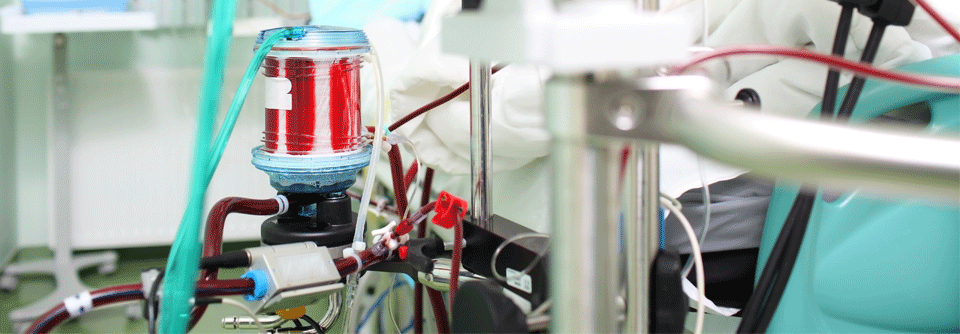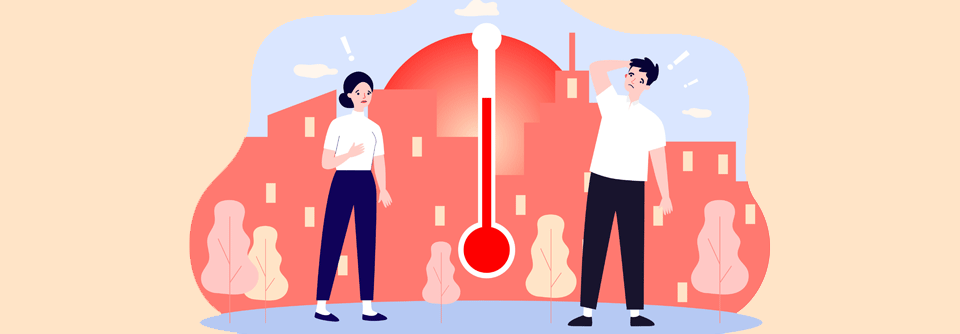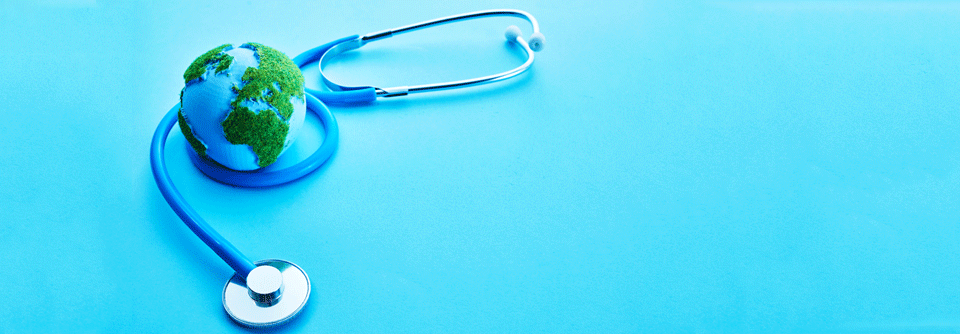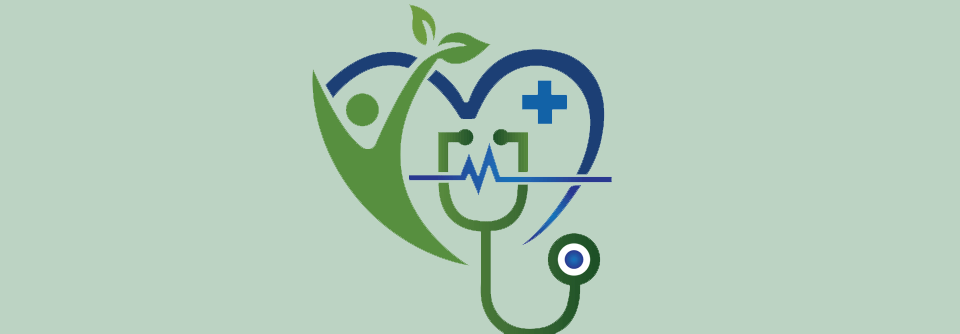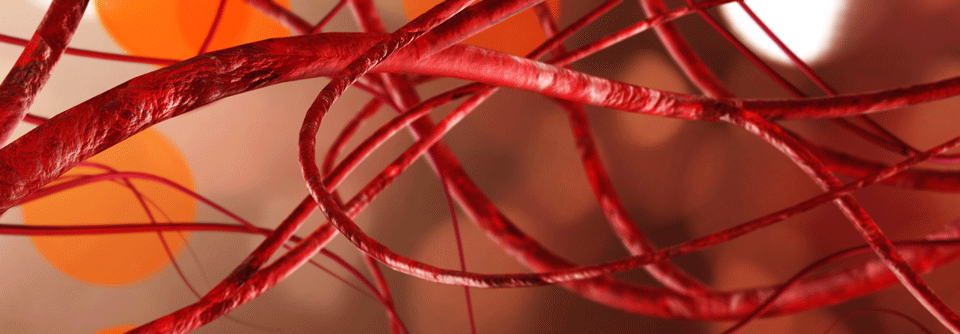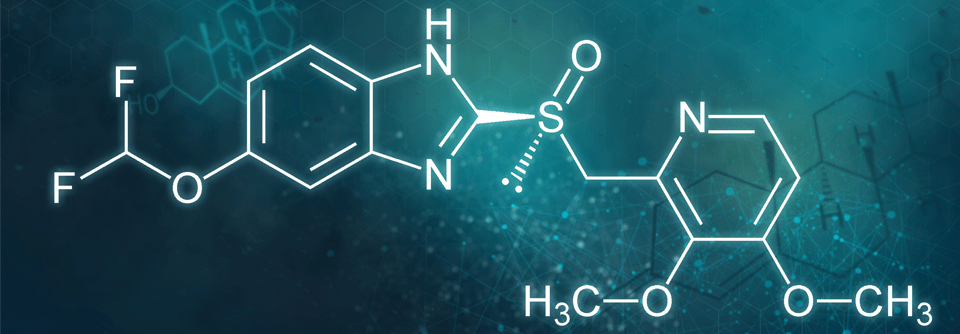Klimaschutz in der Arztpraxis – so lässt sich der Alltag an die Folgen der Erderwärmung anpassen
 Ärztinnen und Ärzte sind zum Klimaschutz bereit,
wünschen sich dabei aber mehr Unterstützung.
© Rudzhan, elroce – stock.adobe.com
Ärztinnen und Ärzte sind zum Klimaschutz bereit,
wünschen sich dabei aber mehr Unterstützung.
© Rudzhan, elroce – stock.adobe.com
Weniger Einwegmaterial, mehr Telemedizin, Ökostrom: Viele Ärzte würden gerne klimabewusster arbeiten und fühlen sich dafür verantwortlich, Patienten über gesundheitliche Risiken des Klimawandels zu informieren. Darauf weist eine Online-Umfrage der Medizinischen Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg hin, die von den Medizindoktoranden Marlene Thöne und Nikolaus Mezger initiiert und auf dem 127. Kongress der DGIM (Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin) vorgestellt wurde. Die meisten der 1600 Befragten führen eine eigene Praxis, rund ein Viertel von ihnen ist angestellt.
Bei Hitze Angebote für vulnerable Patienten schaffen
Über 90 % der Teilnehmenden sind bereit, zwecks Klimaschutz energiesparend mit Geräten und Heizung umzugehen. Doch welche weiteren Maßnahmen können Ärzte ergreifen, um den Arbeitsalltag der globalen Erwärmung anzupassen? Einige Pioniere gaben auf dem Kongress in eigenen Vorträgen Tipps.
Die oft älteren und multimorbiden Patienten der Hausärzte seien während Hitzewellen besonders vulnerabel, gab der hausärztliche Internist Dr. Robin Maitra zu bedenken. In seiner Praxis im baden-württembergischen Hemmingen schafft er während extremer Wetterphasen spezielle Angebote – etwa eine Sprechstunde früh morgens, in der besonders auf eine gute Raumlüftung und kurze Wartezeiten geachtet wird. „Ich denke, das gehört bei uns in Mitteleuropa inzwischen einfach dazu. Das Hitzeproblem wird schlimmer und wir müssen darauf reagieren“, betonte er.
Insbesondere sei sicherzustellen, dass vulnerable Patienten ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen und dass sie von Angehörigen gebracht und geholt werden. Es biete sich zudem an, die Betroffenen im Arzt-Informationssystem zu markieren, um sie während Hitzewellen identifizieren zu können. Auch ihre Medikation sei hinsichtlich Hitze zu prüfen. „Was machen wir mit den Diuretika, was mit der kardialen Medikation, wenn die Temperaturen draußen bei 40 Grad liegen?“, gab Dr. Maitra zu bedenken.
Da Hausärzte ihre Patienten gut kennen, können sie effizient über die Folgen des Klimawandels für die persönliche Gesundheit aufklären. Laut der Studie der Universität Halle-Wittenberg sind rund 80 % der Befragten bereit, solche Beratungen zu leisten. Dr. Maitra nutzt hierfür z.B. den „Check-up“, die Gesundheitsuntersuchung für Patienten ab 35 Jahre. „Beispielsweise kann ich einen Asthmatiker über die Pollengefahr informieren oder über die Feinstaubbelastung. Den Herzkranken kann ich über Herzinsuffizienz aufklären, dem Übergewichtigen zu einem klimaschützenden Verhalten mit mehr Bewegung und gesunder Ernährung raten.“ Die Leute würden sich sehr interessiert an diesem Angebot zeigen, berichtet der Internist.
Der Hausarzt und Psychotherapeut Dr. Ralph Krolewski hat mit der „Klima-Sprechstunde“ ein eigenes Konzept entwickelt, um das Thema „individuelle Gesundheitsvorteile in Verbindung mit Klimaschutz“ systematisch in Arzt-Patienten-Gespräche zu integrieren. In Sachen Mobilität geht er mit gutem Vorbild voran: Er erledigt Hausbesuche auf einer Fläche von 100 km² per Fahrrad, auf kürzeren Strecken nahe seiner Praxis in Gummersbach ist er mit Nordic-Walking-Stöcken unterwegs. „Da ich viele Leute treffe, habe ich als Arzt immer die Gelegenheit, sie anzusprechen. Es löst großes Interesse aus, wenn ich Hausbesuche mit dem Fahrrad mache oder meine Nordic-Walking-Stöcke neben der Haustür parke“, erzählte Dr. Krolewski. „Das gibt immer Gesprächsstoff.“
An- und Abfahrten sind große Emissionsquelle von Praxen
Tatsächlich müssten Praxisteam und Patienten in Sachen Mobilität dringend umdenken: Die zweitgrößte Emissionsquelle von Arztpraxen sei die An- und Abfahrt, erklärte Mezger. Die hausärztliche Internistin Dr. Susanne Balzer gab in ihrem Vortrag zu bedenken, dass viele Fahrten derzeit durch Videosprechstunden und digitale Kongresse entfallen.
Sie leitet das Ressort für Klimaschutz der AG der hausärztlichen Internisten in der DGIM und führt ihre Kölner Praxis papierfrei. Es gebe viele kleine Kniffe, die dabei helfen, berichtete sie. Etwa habe ihr Team die Datenschutzerklärung laminiert. Patienten füllen sie mit Folienstift aus, dann wird sie gescannt und abgewaschen.
Gegen die größte Emissionsquelle der Praxis können Ärzte nur bedingt etwas tun: Analysen zum CO₂-Fußabdruck britischer Arztpraxen hätten gezeigt, dass etwa 60 % bis 95 % der CO₂-Emissionen auf Medikamente entfallen, erklärt Mezger. „Sie entstehen nicht nur in der direkten Patientenversorgung, sondern vor allem durch Herstellung, Transport und Entsorgung.“ 80 % der Studienteilnehmer befürworteten die Erfassung des ökologischenen Fußabdrucks von Arzneimitteln.
Beispiel Hämodialyse
Kongressbericht: 127. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin (Online-Veranstaltung)