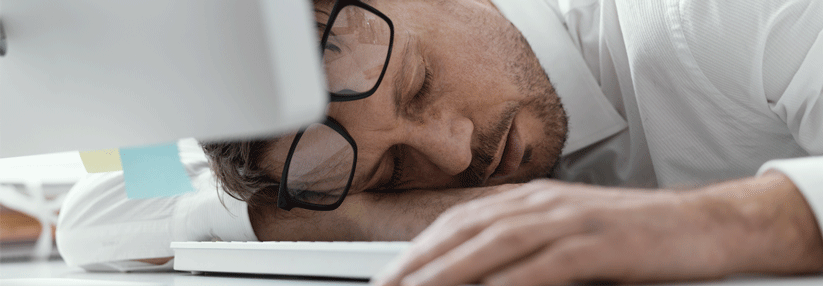
Genetischer Schlüssel zu ME/CFS Acht Genloci könnten mit ME/CFS assoziiert sein
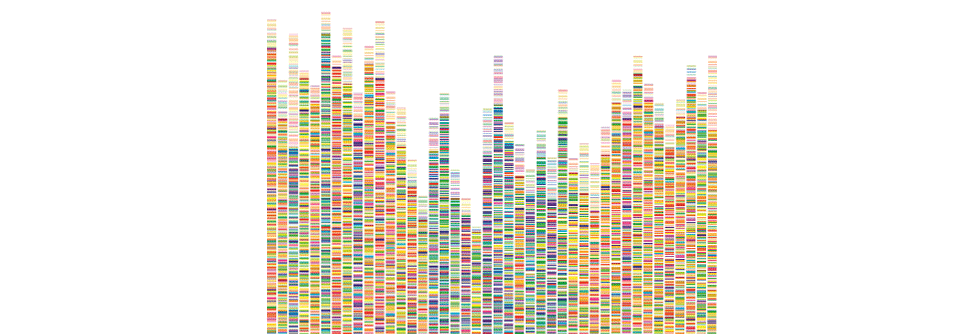 Eine Studie hat acht Genorte identifiziert, die mit ME/CFS assoziiert sein könnten.
© Vladystock - stock.adobe.com
Eine Studie hat acht Genorte identifiziert, die mit ME/CFS assoziiert sein könnten.
© Vladystock - stock.adobe.com
Weltweit leiden schätzungsweise 67 Millionen Menschen an einer bislang noch wenig verstandenen Krankheit: dem chronischen Fatigue-Syndrom. Eine Forschergruppe suchte im Erbgut der Betroffenen nach möglichen Ursachen.
Belastbare wissenschaftliche Erkenntnisse über die myalgische Enzephalitis bzw. das chronische Fatigue-Syndrom (ME/CFS) halten sich bislang in Grenzen. Erkrankt sind zu ca. 80 % Frauen, etwa die Hälfte der Betroffenen gab in einer Studie an, aufgrund der Krankheit das Haus nicht mehr verlassen zu können oder sogar bettlägerig zu sein. Das hervorstechendste Symptom ist die sogenannte post-exertionelle Malaise (PEM). Darunter versteht man eine Verschlimmerung der Symptome bereits nach geringer körperlicher oder mentaler Anstrengung. Typischerweise ereignet sich eine solche Krise mit einer Verzögerung von 12 bis 48 Stunden nach der Aktivität, sie kann Tage bis Wochen anhalten. Weitere Symptome sind Schmerzen und Fatigue, auch nach ausreichendem Schlaf.
Long COVID und andere Infektionen gehen oft voraus
Zwischen 13 % und 45 % der Patientinnen und Patienten mit Long COVID entwickeln ME/CFS. Auch andere Infektionen können dem Syndrom vorausgehen. Die Beschwerden fluktuieren meist, eine vollständige Heilung ist jedoch selten: Nur etwa 5 % erholen sich komplett. Betroffene berichten häufig, dass man ihre Beschwerden nicht ernst nimmt. Einen diagnostischen Test, der die Krankheit nachweist, gibt es nicht.
Bei den Ursachen tappt man bislang im Dunkeln. Da die Erkrankung familiär gehäuft vorkommt, lag es nahe, nach genetischen Risikofaktoren zu suchen. Forschende der DecodeME-Studie untersuchten dazu die DNS von 15.579 Menschen mit ME/CFS und 259.909 nicht Betroffenen aus Großbritannien. Als Untersuchungsmaterial dienten eingesandte Speichelproben.
Keine Risikogene für Depression oder Ängste
Acht Genomlokalisationen waren signifikant mit einer Erkrankung an ME/CFS assoziiert. Drei dieser Genloci könnten auch bei der Antwort des Immunsystems auf virale oder bakterielle Infektionen eine Rolle spielen. Ein Locus wurde in früheren Studien mit chronischen Schmerzen in verschiedenen Körperregionen in Verbindung gebracht. Mit Genvarianten, die das Risiko für Depression oder Angststörungen erhöhen, fanden sich dagegen keine Überschneidungen. Das Erkrankungsrisiko war bei Männern und Frauen gleichermaßen durch die Genloci erhöht.
Da die Genvarianten in den acht beschriebenen Regionen des Genoms auch bei Menschen ohne ME/CFS häufig vorkommen, eignet sich die Suche nach ihnen nicht für einen diagnostischen Test. Außerdem enthalten die identifizierten Regionen jeweils mehrere Gene – welche davon bei ME/CFS eine Rolle spielen, lässt sich derzeit noch nicht sagen.
Die Ergebnisse schaffen jedoch eine Grundlage für weitere Forschung, heißt es in der als Preprint veröffentlichten Untersuchung. Die Wahrscheinlichkeit sei gestiegen, in Zukunft effektive Medikamente zu finden. Der große Stichprobenumfang sorge dabei für eine gute statistische Aussagekraft.
Nun müsse man versuchen, die Ergebnisse zu reproduzieren, und die acht verdächtigen Genloci genauer unter die Lupe nehmen, so die Forschenden. Auf jeden Fall könnte die Erkenntnis, dass bei ME/CFS die Gene eine Rolle spielen – und zwar vor allem solche, die mit dem Immun- und Nervensystem in Zusammenhang stehen –, dabei helfen, gegen die Stigmatisierung der Erkrankten anzukämpfen.
Quelle: DecodeME collaboration. medRxiv 2025; doi: 10.1101/2025.08.06.25333109; Preprint
