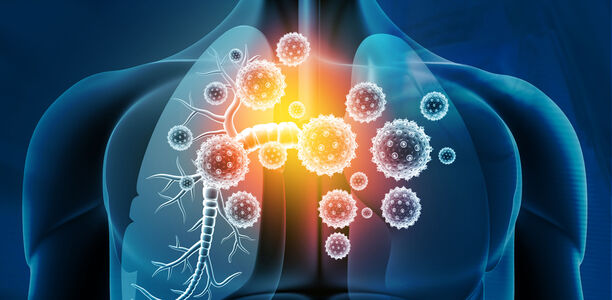Antikörpertests Antikörper als Schlüssel zur Diagnose
 Das Spektrum der autoimmunen Myositiden umfasst mehrere klinische Subtypen.
© H_Ko - stock.adobe.com
Das Spektrum der autoimmunen Myositiden umfasst mehrere klinische Subtypen.
© H_Ko - stock.adobe.com
Das Spektrum der autoimmunen Myositiden umfasst mehrere klinische Subtypen. Dazu gehören neben dem Antisynthetase-Syndrom die Dermato- und die Polymyositis, die immunvermittelte nekrotisierende Myositis und die Einschlusskörpermyositis. Myositiden kommen zudem als Overlap-Myositiden im Rahmen anderer immunologischer Systemerkrankungen vor, z. B. beim Lupus erythematodes, bei systemischer Sklerose oder dem Sjögren-Syndrom.
Muskelbeschwerden können auch fehlen
Klinische Symptome wie Muskelschwäche und -schmerzen sowie die Beteiligung von Haut und Lunge treten bei den einzelnen Subformen in unterschiedlichem Ausmaß auf. Die wegweisende Muskelsymptomatik fehlt allerdings mitunter. Myositisautoantikörper sind hilfreich bei der Diagnose und der Identifizierung von Subgruppen. Außerdem gelten sie als Prognosemarker für die Entwicklung einer interstitiellen Lungenerkrankung (interstitial lung disease, ILD) oder eines assoziierten Tumors.
Eingeteilt werden Myositisantikörper in zwei Gruppen. Die myositisspezifischen Autoantikörper (MSA) sind spezifischer für idiopathische entzündliche Myopathien und treten meist isoliert auf. Die myositisassoziierten Autoantikörper (MAAS) lassen sich hingegen bei vielen verschiedenen rheumatischen Erkrankungen finden. Häufig kommen sie zusammen mit anderen Antikörpern vor, beispielsweise mit Anti-Ro-52.
Wie es sich mit dem positiven Vorhersagewert (positiv predictive value, PPV) von 17 Myositisantikörpern für die Diagnose von Myositis und assoziierten Erkrankungen wie ILD oder Malignitäten verhält, hat eine Arbeitsgruppe um Dr. Anne Kerola vom Institut für Molekularmedizin Finnland an der Universität Helsinki untersucht. Dazu identifizierte das Team zunächst retrospektiv 1.068 Männer und Frauen über 18 Jahren, die zwischen 2015 und 2020 positiv auf mindestens einen Myositisantikörper getestet worden waren (Anti-HMGCR* mittels ELISA, weitere 16 Autoantikörper mittels Line-Blot-Test). Diesen Ergebnissen stellten die Forschenden die klinischen Diagnosen aus den Krankenregistern der Jahre 2013 bis 2022 gegenüber.
Positive prädiktive Werte unterscheiden sich stark
Bei den 1.068 Studienteilnehmenden wurden 1.406 positive Myositisantikörperbefunde identifiziert. Am häufigsten handelte es sich dabei um Anti-Ro-52, Anti-PM-Scl75, Anti-SRP, Anti-Ku72/86, Anti-PL-7 und Anti-Jo-1. Den höchsten PPV für die Diagnose einer Myositis hatten Anti-HMGCR-Antikörper mit 94 %, dahinter folgten die Autoantikörper Anti-MDA5, Anti-Jo-1 und Anti-TIF1-γ (49–54 %). Bei den restlichen Autoantikörpern lag der PPV mit 18–42 % deutlich niedriger.
Die Antikörper unterschieden sich auch stark in ihrer Vorhersagekraft für eine ILD. Sie lag für Anti-Synthetase-Antikörper, Anti-MDA5, Anti-PM-Scl100, Anti-SAE1 and Anti-Ro-52 zwischen 25–47 %. Malignitäten wurden am häufigsten bei Anti-TIF1-γ-positiven Patientinnen und Patienten (PPV 38 %) festgestellt, gefolgt von Anti-PL-7-positiven Individuen (PPV 32 %). Den höchsten prädiktiven Wert für die Entwicklung von Kollagenosen hatte Anti-Ro-52 mit einem PPV von 57 %.
Insgesamt variierten die Vorhersagewerte der verschiedenen Antikörper also erheblich, unterstreicht das Autorenteam. Höhere PPV lassen sich erreichen, wenn man die Bandenintensität der einzelnen Marker betrachtet. Sie zeigt an, wie stark der Antikörper mit seinem Zielantigen reagiert. Stärkere Bandenintensitäten waren mit höheren PPV für Myositis und Kollagenosen verbunden, nicht jedoch für interstitielle Lungenerkrankungen oder Malignitäten.
Ebenso wird der PPV durch überlappende Antikörperbefunde verstärkt. Die gleichzeitige Positivität für zwei oder mehr Myositisantikörper im Vergleich zu einem Einzelnachweis war mit einem höheren Risiko für Myositis, Kollagenosen und ILD verbunden.
* Anti-3-Hydroxy-3-Methylglutaryl-CoA-Reduktase
Quelle: Kerola AM et al. RMD open 2025; 11: e005007; DOI: 10.1136/rmdopen-2024-005007