
Nicht bis zur Senkung warten Besserer Beckenbodenschutz durch frühzeitige Pessartherapie nach Geburt und Menopause
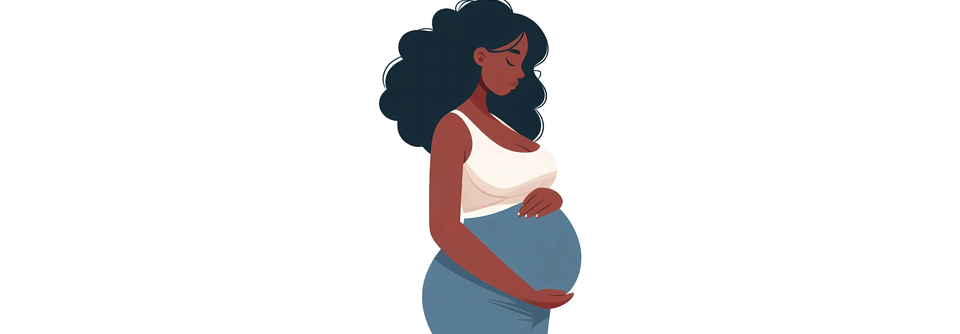 Eine vaginale Geburt stellt eine erhebliche Belastung für Muskulatur und Bindegewebe des Beckenbodens dar.
© Shelley - stock.adobe.com (Generiert mit KI)
Eine vaginale Geburt stellt eine erhebliche Belastung für Muskulatur und Bindegewebe des Beckenbodens dar.
© Shelley - stock.adobe.com (Generiert mit KI)
Eine vaginale Geburt stellt eine erhebliche Belastung für Muskulatur und Bindegewebe des Beckenbodens dar. Um einer postpartalen Senkung vorzubeugen, hat man lange Zeit nur die Muskulatur des Beckenbodens trainiert und das Bindegewebe meist sträflich vernachlässigt. Dabei lässt es sich durch eine Pessartherapie effizient stützen, schreiben Prof. Dr. Ralf Tunn vom Alexianer St. Hedwig-Krankenhaus und Dr. Graziana Antoci vom St. Joseph Krankenhaus, beide in Berlin.
Zum Einsatz kommt die Pessartherapie bisher leitliniengemäß nur zur Behandlung eines symptomatischen Descensus genitalis und einer Belastungsinkontinenz. In Gebrauch sind dafür vor allem Würfelpessare, die durch die Sogwirkung ihrer konkaven Oberflächen an der Scheidenwand haften und sich auf dem Beckenboden abstützen. Damit werden zwar die abgesunkenen Strukturen reponiert, aber der Beckenboden wird nur eingeschränkt druckentlastet.
Neues Pessarmodell führte zum Umdenken
Anders verhält es sich bei einem neuartigen Pessar, das retrosymphysär passiv gestützt wird. Es bietet wirkliche Entlastung für die bindegewebigen Haltestrukturen des Beckenbodens. Erst mit Einführung dieses Modells kam die Diskussion auf, ob man es nicht früh postpartal einsetzen kann, um die Rekonvaleszenz des Beckenbodens zu fördern.
Das neue Modell wurde in einer multizentrischen prospektiven Studie geprüft. Über 850 Frauen erhielten das Pessar nach der Geburt ausgehändigt mit der Empfehlung, es nach Ablauf von acht Wochen nach der Geburt einzusetzen. Eine Erinnerung per E-Mail zu diesem Zeitpunkt und professionelle Unterstützung beim ersten Einsetzen sollten die Compliance fördern. Zwei, drei und sechs Monate nach der Geburt nutzten 119, 85 bzw. 38 Frauen das Pessar, etwa jede zweite davon täglich. Und sogar fast alle Anwenderinnen, die keine Beschwerden hatten, empfanden dadurch ein größeres Stabilitätsgefühl. Frauen mit Beckenbodenproblemen zeigten nach zwölf Monaten eine höhere Pessar-Compliance. Ihre Werte im Bladder-and-Pelvic-Organ-Prolapse-Score waren signifikant verbessert.
Eine randomisierte Studie ergab, dass eine postpartale Therapie mit dem Würfelpessar Inkontinenzsymptome ebenfalls signifikant stärker reduzierte als ein Rückbildungskurs oder eine Physiotherapie. Als erfolgreich erwies sich in einer weiteren Untersuchung die Anwendung eines Ringpessars.
Aufgrund dieser Evidenzlage rät das Autorenteam dazu, allen Frauen nach vaginaler Geburt die Pessartherapie anzubieten. Beginnen kann man damit idealerweise am Ende der Wochenbettphase. Prof. Tunn und Dr. Antoci schließen weiter daraus, dass auch eine frühe postmenopausale Anwendung dieser Therapie sinnvoll erscheint. Denn das Beckenbodenbindegewebe ist in dieser Lebensphase durch Östrogenmangel und Atrophie chronisch geschädigt.
Empfohlen wird diese Maßnahme bisher erst bei einem symptomatischen Descensus zweiten Grades. Die Frauen haben zu diesem Zeitpunkt aber schon einen langen Leidensweg hinter sich. Und ein stark fortgeschrittener Prolaps kann auch mit großen Pessaren oft nicht mehr zurückgehalten werden. Würde man schon bei einem Deszensus ersten Grades mit dieser Therapie beginnen, ließe sich der Beckenboden besser stabilisieren. Ergänzend ist eine lokale Östrogenanwendung zu empfehlen.
Quelle: Tunn R, Antoci G. Gynäkologie 2025; doi: 10.1007/s00129-024-05329-4

