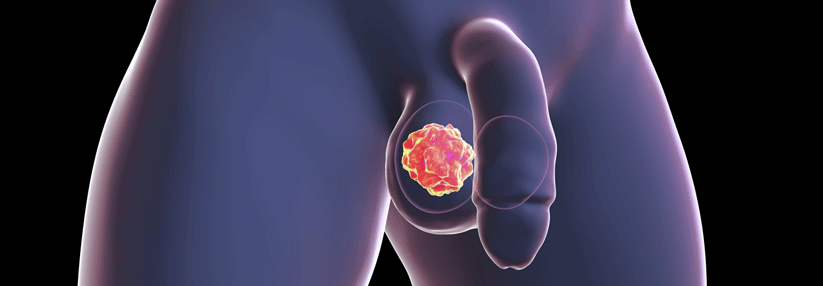
Hausärzte sichern die Prognose Früherkennung bei Hodenkrebs entscheidend
 Organsparende Operationstechniken führen zu guten onkologischen Ergebnissen und verringern das Risiko einer Infertilität.
© Андрей К – stock.adobe.com
Organsparende Operationstechniken führen zu guten onkologischen Ergebnissen und verringern das Risiko einer Infertilität.
© Андрей К – stock.adobe.com
Der häufigste solide Tumor bei jungen Männern betrifft den Hoden. Dank verbesserter Therapiemöglichkeiten ist die Mortalität beträchtlich gesunken. Erste Ansprechpartner der Betroffenen sind oft die Hausärztin oder der Hausarzt. Sie stellen die Weichen für die Behandlung. Bei etwa 95 % der testikulären Malignome handelt es sich um Keimzelltumoren. Unterschieden werden Seminome und Nichtseminome. Besonders gefährdet sind Patienten mit Kryptorchismus (vier- bis achtfach erhöhtes Risiko). Die Gefahr steigt mit dem Ausmaß des Hochstands und der Zeitspanne bis zur operativen Korrektur. Männer mit Infertilität oder gestörtem Spermiogramm haben ein 3- bis 20-faches Risiko, schreibt ein Autorenteam um Dr. Julian Chavarriaga von der University of Toronto.
Eine In-situ-Läsion im kontralateralen Hoden liegt bei 5 % der Betroffenen mit Keimzelltumor vor. Unbehandelt bildet sich daraus innerhalb von sieben Jahren in etwa 70 % der Fälle ein Malignom. Ein weiterer starker Einflussfaktor ist die familiäre Belastung, vor allem bei erstgradig Verwandten.
Die häufigsten Befunde bei den Patienten sind schmerzlose Geschwulste, testikuläre Schwellungen oder asymptomatische Veränderungen im Ultraschall. Etwa ein Drittel der Männer leidet an dumpfen Hodenschmerzen, etwa 10 % haben eine akute Algesie, meist ausgelöst durch Infarzierung oder Hämorrhagie. Auch Hydrozele und Gynäkomastie können erste Anzeichen von Hodenkrebs sein.
Skrotale Sonografie zeigt auch kleine Veränderungen
Das primäre bildgebende Verfahren ist die skrotale Sonografie. Mit ihr lassen sich bereits kleine Veränderungen (1–2 mm) aufspüren. In unklaren Fällen kann eine MRT weiterhelfen. Wenn eine Diagnose mit Ultraschall oder speziellen Tumormarkern nicht möglich ist, bleibt die radikale Orchidektomie die primäre diagnostische und therapeutische Intervention.
Zunehmend eingesetzt werden organsparende Techniken. Dies gilt vor allem bei kleiner Testis (< 30 % des Hodenvolumens), bilateralem Befall, Neoplasie im Einzelhoden und nur geringem Malignomverdacht. Diese Strategie führt zu guten onkologischen Ergebnissen und verringert das Risiko für postoperative Infertilität und Hypogonadismus. 70–90 % der Patienten haben sieben Jahre nach dem Eingriff noch eine normale Testosteronproduktion.
Alle Patienten mit Hodenkrebs sollten sich vor der Orchidektomie einer bildgebenden Staging-Diagnostik unterziehen. Diese kann jedoch aufgeschoben werden, bis das Malignom histologisch gesichert ist. Prognose und initiale Therapie hängen vom klinischen Stadium ab.
Therapie reicht von aktiver Überwachung bis Radiatio
Patienten im Stadium I haben ein reines Seminom, keine AFP*-Erhöhung und normalisierte Tumormarker nach der Orchidektomie. Therapeutisch besteht die Wahl zwischen engmaschiger Beobachtung, adjuvanter Gabe von Zytostatika und Radiatio. Am häufigsten eingesetzt wird die aktive Überwachung. Sie ermöglicht die frühzeitige Detektion von Rezidiven. Das Fünfjahresrisiko für einen Rückfall liegt im Stadium I bei rund 12–17 %, mehr als 90 % dieser Tumoren manifestieren sich in den retroperitonealen Lymphknoten.
In den Stadien IIA und IIB nach Orchidektomie wird initial meist eine Beobachtung empfohlen mit erneutem Staging nach sechs bis acht Wochen. Klinische IIA-Patienten und manche mit Stadium IIB (Tumor ≤ 3 cm) können erfolgreich mit Chemotherapie, Radiotherapie oder primärer retroperitonealer Lymphknotendissektion behandelt werden. Bei größeren Malignomen (3–5 cm) wird die initiale Zytostatikagabe bevorzugt. Seminompatienten in den Stadien IIC und III sollten primär antitumoröse Wirkstoffe erhalten.
Wie beim Seminom ist auch bei den meisten Männern mit nicht-seminomatösem Keimzelltumor im klinischen Stadium I die engmaschige Beobachtung das Vorgehen der Wahl. Die krebsspezifische Überlebensrate ohne weitere Therapie liegt bei 99 %.
In den Stadien IIA und IIB lässt sich mit geeigneter und rechtzeitiger Therapie eine Heilungsrate von 98 % erreichen. Zur Verfügung stehen zwei Optionen: die retroperitoneale Lymphknotendissektion und die Chemotherapie. Letztere wird für alle nodal-positiven Patienten empfohlen.
Die Chemotherapie hat jedoch eine gewisse Toxizität und bis zu 70 % der Männer würden auch ohne sie überleben. In den Stadien IIC und III des nichtseminomatösen Keimzelltumors wird nach der Chemotherapie eine operative Resektion empfohlen, wenn die verbliebene Tumormasse einen Durchmesser größer als 1 cm hat.
| Klinische Stadieneinteilung |
|---|
| Stadium I: Erkrankung klinisch auf den Hoden beschränkt |
| Stadium IS: Klinisch nur Hodenbefall, aber erhöhte Tumormarker nach Orchidektomie |
| Stadium II: Regionale (retroperitoneale) Lymphknotenmetastasen |
| Stadium III: Nicht regionale Lk-Filiae, viszerale Metastasen oder erhöhte Tumormarker |
Quellen: Chavarriaga J et al. Lancet 2025; 406: 76-90;doi: 10.1016/S0140-6736(25)00455-6

