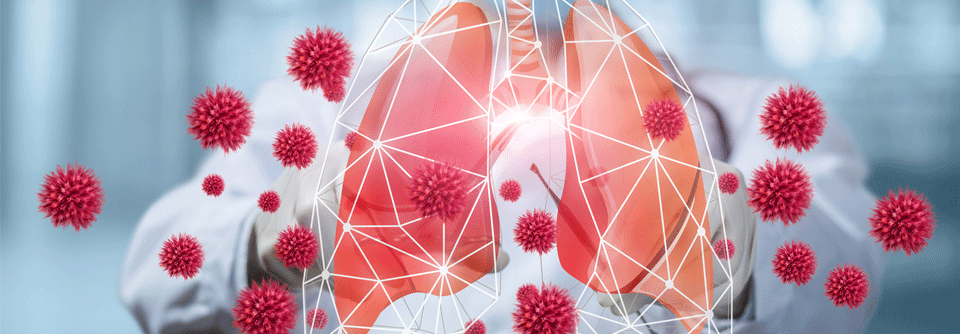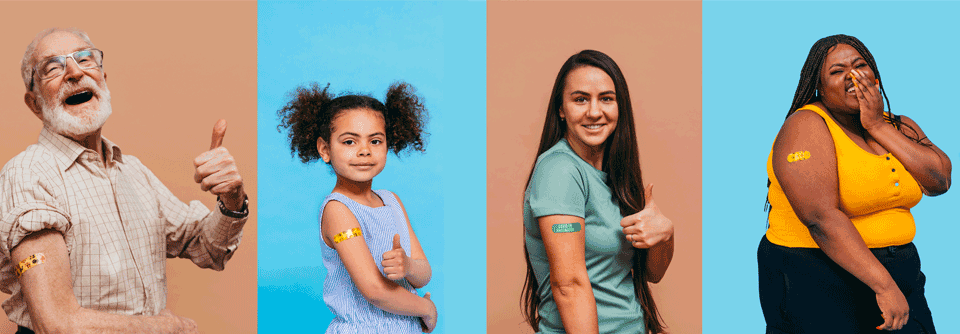
Impfung schützt Herz und Gefäße Immunisierungen als vierte Säule der Herzprävention
 Allein durch die Influenzaimpfung lässt sich die Inzidenz von schwerwiegenden Herz-Kreislauf-Ereignissen um 30 % senken.
© Ratana21 – stock.adobe.com
Allein durch die Influenzaimpfung lässt sich die Inzidenz von schwerwiegenden Herz-Kreislauf-Ereignissen um 30 % senken.
© Ratana21 – stock.adobe.com
Ob durch Influenzaviren, SARS-CoV-2 oder Pneumokokken: Viele Atemwegsinfektionen bergen die Gefahr von Komplikationen am Herz-Kreislauf-System. Entsprechend dienen die jeweiligen Impfungen der kardiovaskulären Prävention. Welche Zielgruppen davon besonders profitieren, fasst ein aktuelles Konsensus-Statement zusammen.
Zu den etablierten pharmakologischen Strategien, um Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorzubeugen, zählen Antihypertensiva, Lipidsenker und Antidiabetika. Daneben sollte man Impfungen als vierte Säule der medikamentösen kardiovaskulären Prävention betrachten, fordert ein Expertenteam der ESC* um Prof. Dr. Bettina Heidecker vom Deutschen Herzzentrum der Charité – Universitätsmedizin Berlin. Die Autorinnen und Autoren veröffentlichten kürzlich ein Konsensus-Papier, das die wichtige Rolle des Impfens in diesem Zusammenhang beschreibt.
Die COVID-19-Pandemie hat verdeutlicht, dass virale Atemwegsinfektionen Komplikationen wie Herzinfarkte, Arrhythmien oder eine Herzinsuffizienz begünstigen können. Doch nicht nur Infekte durch SARS-CoV-2 gehen mit einem erhöhten Herz-Kreislauf-Risiko einher, sondern auch solche durch andere Erreger wie Influenza-, Parainfluenza- und Adenoviren, RSV oder Pneumokokken.
Pulmonale und systemische Infektionen können die Herz-Kreislauf-Gesundheit über unterschiedliche Mechanismen beeinflussen. Sie erhöhen z. B. den myokardialen Sauerstoffverbrauch und begünstigen dadurch ischämische Ereignisse bei Risikopersonen. Außerdem stimulieren sie inflammatorische Stoffwechselwege, was u. U. eine Ruptur oder Erosion von Koronarplaques triggert. Nicht zuletzt beeinträchtigen Infektionen die myokardiale Kontraktilität, sodass eine Herzinsuffizienz exazerbieren kann.
Es gibt immer mehr Evidenz dafür, dass Impfstoffe gegen Influenza, SARS-CoV-2, RSV und andere Viren Infektionen signifikant reduzieren. Für Influenza wurde zudem ermittelt, dass die Inzidenz von schwerwiegenden kardiovaskulären Ereignissen (major adverse cardiovascular events, MACE) bei Geimpften um 30 % sinkt. Für die Polysaccharid-Vakzine gegen Pneumokokken zeigte sich, dass sie bei Menschen ab 65 Jahren Herz-Kreislauf-Ereignisse um 10 % senkt.
Bei Immunsuppression immer zuvor Expertenrat einholen
Der Nutzen von Impfungen im Hinblick auf MACE ist bei bestimmten Risikofaktoren besonders ausgeprägt. Zu diesen Faktoren zählen:
- höheres Alter
- angeborene Herzkrankheit
- Schwangerschaft
- Z.n. Herztransplantation
- bestehende KHK
Wenn Immunsupprimierte geimpft werden sollen, ist vorab immer der Rat einer Infektionsspezialistin oder eines -spezialisten einzuholen. Lebendvakzine sind bei Immunschwäche im Allgemeinen kontraindiziert.
Eine kürzlich durchgemachte akute kardiale Erkrankung scheint im Hinblick auf Impfungen im Allgemeinen kein Problem zu sein. So ergab eine aktuelle Studie, dass eine Influenzaimpfung auch dann sicher ist und die kardiovaskuläre Mortalität senkt, wenn sie innerhalb von 72 Stunden nach einem akuten Myokardinfarkt verabreicht wird.
Patientinnen und Patienten mit moderater bis schwerer und/oder zyanotischer kongenitaler Herzerkrankung und Personen mit pulmonalarterieller Hypertonie sollten sich jährlich gegen Influenza immunisieren lassen, rät das Expertenteam. Bei Betroffenen mit angeborenem Herzleiden bestehen zudem keine besonderen Bedenken hinsichtlich eines imCOVID-19-Schutzes. Schwangeren werden Impfungen gegen COVID-19, RSV, Influenza und Keuchhusten empfohlen.
Kaum schwere Reaktionen
Schwere Nebenwirkungen sind bei den meisten Impfungen sehr selten (Inzidenz unter 10 pro 100.000), sie treten jedoch bei jüngeren Menschen häufiger auf. Zu den möglichen Reaktionen zählen Myokarditis, Perikarditis und – noch seltener – Anaphylaxie, Immunthrombozytopenie und Enzephalitis/Meningitis.
Nach SARS-CoV-2-Impfungen wurden insbesondere bei jungen Männern Myokarditisfälle beobachtet. Das Autorenteam weist aber darauf hin, dass das Risiko einer Herzmuskelentzündung durch COVID-19 sechsmal höher liegt als nach einer Coronaimpfung. Und die meisten impfbedingten Fälle verliefen mild und heilten spontan.
Menschen mit einem Herztransplantat sind aufgrund der Immunsuppression besonders infektanfällig. Bei ihnen bietet sich bereits vor der Transplantation ein umfangreiches Impfprogramm an (u. a. gegen Influenza, Pneumokokken, SARS-CoV-2, aber auch gegen Masern/Mumps/Röteln, Varizellen, Herpes zoster, humane Papillomviren).
Die Autorinnen und Autoren des Konsensus-Statements weisen abschließend auf bestehende Wissenslücken hin. So ist die Datenbasis für Influenza, SARS-CoV-2 und Pneumokokken zwar einigermaßen solide, für andere Vakzine aber lückenhaft. Mehr Evidenz wünscht sich das Expertenteam auch zu Impfungen bei selteneren kardiovaskulären Erkrankungen.
* European Society of Cardiology
Quelle: Heidecker B et al. Eur Heart J 2025; doi: 10.1093/eurheartj/ehaf384