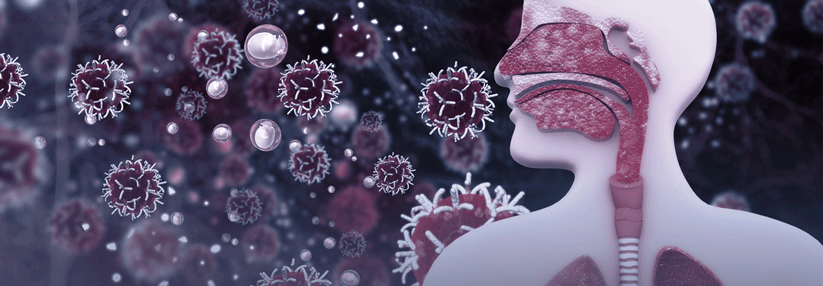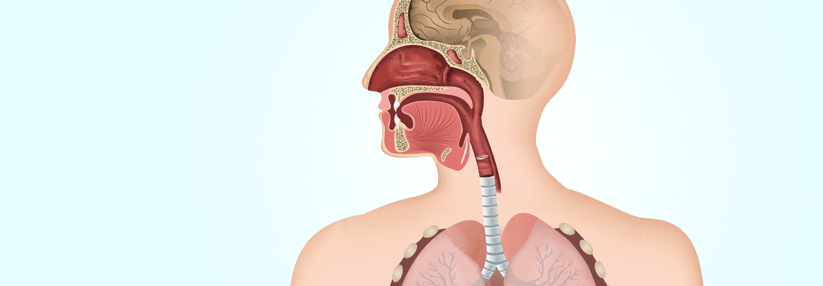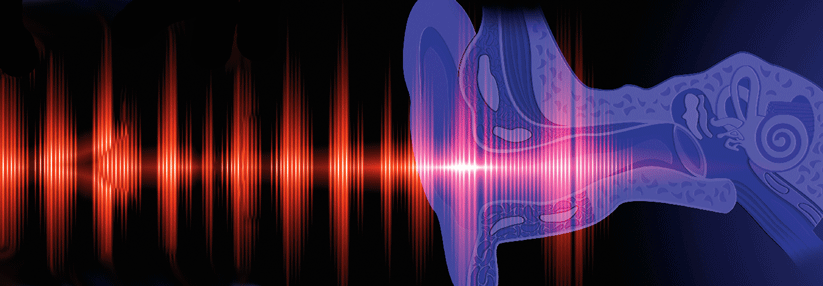
Lebensqualität nach Therapie stabilisiert Kopf-Hals-Tumor: App unterstützt Nachsorge
 Das Hauptziel der Behandlung von Kopf-Hals-Krebs ist krebsfreies Überleben, eine App unterstützt bei langfristigen Folgen.
© sharafat – stock.adobe.com
Das Hauptziel der Behandlung von Kopf-Hals-Krebs ist krebsfreies Überleben, eine App unterstützt bei langfristigen Folgen.
© sharafat – stock.adobe.com
Um die Lebensqualität über die lebenslange Nachsorge hinweg zu erhalten, prüfte eine internationale Forschungsgruppe um Prof. Dr. Stefano Cavalieri vom Nationalen Tumorinstitut in Mailand eine Smartphone-App mit einer dahinterliegenden webbasierten Plattform.1 Das BD4QoL-Forschungsprojekt wurde von der EU gefördert.
410 Patient:innen mit einem nicht metastasierten Kopf-Hals-Tumor, die eine kurative Therapie erhalten hatten, wurden im Verhältnis 2:1 in einen Interventions- und einen Kontrollarm randomisiert. Im Interventionsarm stand den Teilnehmenden die BD4QoL-Plattform zur Verfügung, in die eine App für das Smartphone der Patient:innen und ein Dashboard für Kliniker:innen integriert war.
Dokumentation, motivierende Hinweise und Alarmfunktion
Die Patient:innen konnten Symptome und Befinden dokumentieren, erhielten motivationelle Botschaften und es gab eine KI-gestützte Kommunikation. Bei entsprechenden Konstellationen wurde ein Alarm ausgelöst, zum Kontakt mit dem Arzt oder der Ärztin aufgefordert und je nach Art des Problems wurde auch direkt eine Information an das versorgende klinische Team verschickt. Im Kontrollarm erfolgte eine Standardnachsorge.
Primärer Endpunkt der Studie war der Anteil der Patient:innen, die über einen Zeitraum von zwei Jahren einen Abfall im selbst berichteten allgemeinen Gesundheitszustand (GHS) nach dem EORTC QLQ-C30 von zehn Punkten und mehr aufwiesen. Das sei der Wert, der für klinisch relevant erachtet wird, erläuterte Prof. Cavalieri. Eine Untersuchung im Vorfeld der Studie hatte eine Verschlechterung des GHS bei Langzeitüberlebenden eines Kopf-Hals-Tumors in diesem Rahmen von 20 % ergeben.
Abfall der Lebensqualität bei 10 % statt 20 %
Die Abfrage der Lebensqualität erfolgte in beiden Gruppen unabhängig von der Plattform alle sechs Monate. Fast alle Patient:innen füllten die Fragebögen regelmäßig aus. Die kurative Therapie lag bei Studieneintritt im Median 17,9 Monate zurück, zwei Drittel waren operiert und drei Viertel bestrahlt worden. 51 % hatten eine systemische Therapie erhalten.
Ein Abfall von zehn Punkten und mehr im EORTC-C30-GHS fand sich bei 20,1 % der Patient:innen im Standardnachsorgearm und bei 10,2 % im Interventionsarm, berichtete Prof. Cavalieri. Der Median des Überlebens ohne GHS-Verschlechterung war in beiden Gruppen noch nicht erreicht, der Unterschied aber bereits signifikant (HR 0,46; 95%-KI 0,27–0,78; p = 0,0041).
Wegbereiter für einen Paradigmenwechsel?
Das sei die erste randomisiert-kontrollierte Studie, die einen Lebensqualitätsvorteil mit einem App-basierten Tool als primären Endpunkt in der Nachsorge von Kopf-Hals-Tumoren berichtet, betonte Prof. Cavalieri. Die Studie bedeute eine solide Evidenz für die Verbesserung der Versorgung von Überlebenden mit Kopf-Hals-Tumoren durch ein digitales verhaltensbasiertes Monitoring. Er hofft, dass dieser Ansatz einen Paradigmenwechsel auslöst und den Weg bahnt für eine digital assistierte, proaktive und patientenzentrierte Nachsorge in der Onkologie überhaupt.
Quelle:
Cavalieri S. ESMO Congress 2025; LBA49