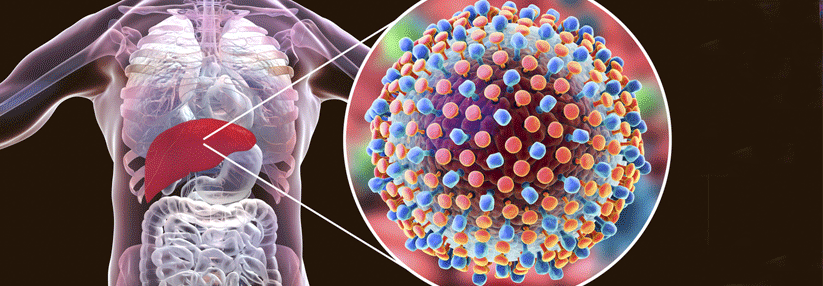Was sich im HCC tummelt Leberkrebs: Mikrobiomanalysen von Leberproben liefern neue Erkenntnisse
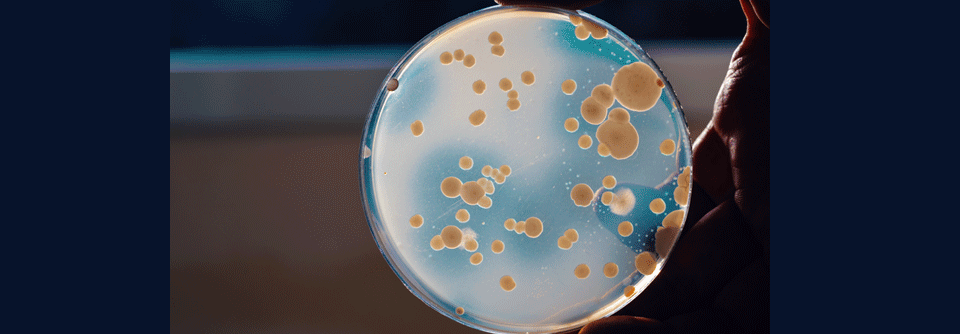 Das Mikrobiom könnte beim HCC eine Rolle spielen.
© luchschenF – stock.adobe.com
Das Mikrobiom könnte beim HCC eine Rolle spielen.
© luchschenF – stock.adobe.com
Trotz steigender Evidenz dafür, dass das Tumormikrobiom Progression und Outcome eines HCC beeinflusst, erfolgten viele Analysen bisher indirekt und es bleiben Wissenslücken. Ein Team um PD Dr. Christian Schulz, LMU Klinikum München, untersuchte nun Gewebsproben von 20 HCC-Erkrankten aus der SORAMIC-Studie und wertete diese abhängig von Krankheitsstadium und -verlauf aus. Zehn der Patient:innen eigneten sich für eine lokale Ablation (kurative Gruppe) wohingegen der Rest eine palliative Behandlung erhielt.
Sowohl bei kurativ als auch bei palliativ behandelten Personen ließ sich eine bakterielle Besiedlung von Tumorherden und umliegendem Lebergewebe nachweisen. Dabei handelte es sich überproportional um Vertreter des Genus Bacilli und Arten, die im oberen Gastrointestinaltrakt vorkommen, z. B. Streptococcus spp., Gemella haemolysans und Helicobacter pylori. Dabei unterschied sich das Bakterienprofil zwischen HCC-Läsionen und gesundem Lebergewebe, auch wenn keine Marker für eine eindeutige Abgrenzung identifiziert wurden.
In der Gruppe mit unheilbarer Erkrankung fiel die Diversität des Mikrobioms insgesamt höher aus als in früheren Stadien und korrelierte mit einem kürzeren Überleben. Zusätzlich schien eine höhere Vielfalt auch mit einer größeren Anzahl von Läsionen einherzugehen.
Mikrobiom zeigt mögliche Trends
Trotz der geringen Fallzahl erkannten die Forschenden Trends für einzelne Arten, die allerdings nicht statistisch signifikant waren. G. haemolysans hatte beispielsweise eine höhere Prävalenz unter Palliativpatient:innen sowie Teilnehmenden, die weniger als 16 Monate überlebten. H. pylori fand sich wiederum vermehrt bei kurativ behandelten Patient:innen mit längerer Überlebensdauer und ausschließlich im Tumor, aber nicht in gesunden Gewebsproben.
Aus Sicht der Autor:innen sprechen die Ergebnisse für die Bedeutung einer Dysbiose beim HCC. Einige nachgewiesene Arten hätten proinflammatorisches und/oder onkogenes Potenzial und seien damit eventuell in Pathomechanismen involviert. Auch wenn viele Beobachtungen noch in größeren Kohorten bestätigt werden müssen, könnte die Modulation des Mikrobioms einen erforschenswerten Therapieansatz darstellen.
Quelle:
Schulz C et al. Gut Pathog 2025; 17(1): 53; DOI: 10.1186/s13099-025-00727-y